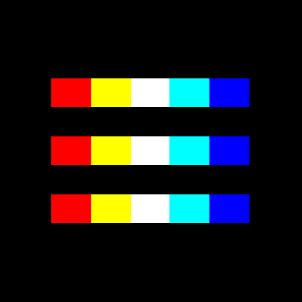6. Fazit
- Marinus Börlin
- 30. Jan. 2023
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023

Im Verlauf dieser Forschung habe ich die Glitch Art auf unterschiedlichen Ebenen und unter diversen Gesichtspunkten analysiert und diskursive Öffnungen sowie Eingrenzungen des Genres beschrieben. Die facettenreichen Aspekte, die darin erkundet wurden, umfassen einerseits exemplarische Momentaufnahmen, entlang welcher die Glitch Art genealogisch Form angenommen hat und andererseits Bedingungen und Beschreibungen dieses dynamischen Prozesses selbst; Knotenpunkte und das Netz, das sie verbindet. Auch wenn diese Erkenntnisse sehr verschiedene Dinge umfassen und nicht in jeder Hinsicht vereinbar sind, ist es doch möglich, einige Schlussfolgerungen zu ziehen, welche die Form von übergreifenden Beobachtungen annehmen. Nicht zuletzt sind die hier im Fazit angesprochenen Aspekte selbst Ausgangspunkte für eine weitere mögliche Forschung.
Im Genre von Glitch Art kommen eine Vielzahl diverser Praktiken, Prozesse, Stilelemente und Positionen zusammen. Diese Pluralität verhindert eine umfassende Definition anhand einer einzelnen dieser Kategorien. Auch eine Liste von dem, was Glitch Art umfasst, muss aufgrund ihrer Offenheit und Verbindung zu sich stets verändernden Technologien wohl mit einem "usw." schließen. "These terms", schreibt Nick Briz, "can be expanded to include much more than might immediately come to mind. This is because at their core they're simply a loose link to a key concept: the interest in the 'mistake'".[1] Während es also schwer ist festzuschreiben, was Glitch Art ist, können sehr wohl unterschiedliche Tendenzen untersucht und beschrieben werden sowie die diskursiven Formationen hinter den Argumenten von Inklusion und Exklusion.
Wenn sich die Praktizierenden der Glitch Art mit Fehlern und Störungen auseinandersetzen, die beispielsweise photographische Bilder in Reihen von Pixeln und Pixelblöcken auflösen, werden programmierte Strukturen erkennbar, welche die Kommunikationstechnologien ausmachen. Auf einer formalen Ebene erinnert diese Strategie an das modernistische Programm, eine Medienspezifik aufzuzeigen. Unter ideologischen Gesichtspunkten richtet sie sich gegen die technizistischen Mythen von Perfektion, Eindeutigkeit und Kontrollierbarkeit. Und in einer metaphorischen Übertragung steht sie für die Erkenntnis, dass diese Narrative nicht an Schnittstellen oder anderen konstruierten Grenzen enden.
Ein Glitch, wie er in der visuellen Glitch Art verstanden wird, ist eine flüchtige und unerwartete Störung von Informationsflüssen, deren wahrnehmbare Folgen einen elementaren Teil ausmachen. Der Charakter der Flüchtigkeit beschreibt einerseits eine Temporalität, aber viel wichtiger grenzt er dadurch den Glitch von einer Störung ab, die endgültig ist und das System zerstört. "System failure is invisible",[2] wie Betancourt schreibt. Als Störung ist der Glitch partiell, nur auf gewisse Aspekte des Systems bezogen, was zur Frage führt, welche das jeweils sind. In ihrer "failure to fully fail"[3] verweisen die Glitches auf die Funktionsweisen der Systeme, die sie stören. Insofern die Störung entgegen, aber innerhalb einer Funktionalität abläuft, steht die Funktionsweise demzufolge gerade nicht für ein Element, das sich rein technisch oder strukturell erklären lässt. Viel mehr hängt die Funktionsweise mit der Intention respektive der Normativität, die in der Technik eingeschrieben ist, zusammen. Der Glitch ist die Verbindung eines unerwünschten Inputs – Veränderungen in der Stromspannung, "noisy data", nicht-binäre Identitäten usw. – und des unerwünschten Outputs, welcher resultiert, weil der Input trotzdem prozessiert wurde. Dadurch deutet der Glitch auf die Kontingenz der als richtig erachteten Funktionsweise hin und eröffnet Raum für Alternativen.
In Takeshi Muratas Monster Movie (2005) zeigt sich beispielsweise sowohl die Organisation der Bilder im Kontext digitaler Datenkompression und -verarbeitung, sowie die Indifferenz dieser Systeme gegenüber Vorstellungen von Funktionalität und Kohärenz auf der Ebene der menschlichen Wahrnehmung und Sinnzuschreibung. Über Glitch Praktiken wie das Datamoshing, fördert die Glitch Art eine Wahrnehmung, welche die Konstitution und Kontingenz der Systeme hervorhebt, was im Kontext der Bild- und Video Glitch Art etwa das System der bildlichen Repräsentation durch digitale Daten ist. In Untitled Game (1996-2001) dekonstruiert JODI die Vorstellungen eines Computerspiels, das anhand von klaren Zielen, Belohnungen und Konsequenzen strukturiert ist. Das Spiel wird durch ihre Transformationen unbrauchbar, aber nur im Verhältnis zu konventionellen Erwartungen, die ein Spiel eines bestimmten Genres mit sich bringt. Auf allgemeinerer Ebene zeigt die Glitch Praxis in Computerspielen auf, wie zwischen den User:innen und der Technologie experimentell explorativ neu verhandelt wird, was Funktionalität und was ein Fehler ist. Wenn Speedrunner:innen die Glitches aufsuchen und ausnutzen, um schneller an ein Ziel zu kommen, stellen diese für sie keine Fehler mehr dar, sondern ein Potential.
Die für gewisse puristischen Positionen prekäre Lage von Glitch Art – zwischen Fehler und Design, kritischem Moment und populärer Ästhetik – hängt so gerade mit ihrem Charakter, respektive Gegenstand zusammen, worin Erkundung und Aneignung einen fortlaufenden, wechselseitigen Prozess darstellen. In der explorativen Herangehensweise werden Störungen und Potentiale entdeckt. Die Glitch Art folgt dabei regelmäßig einer Trial-and-Error-Strategie, aber auch Methoden des Unblackboxing. Sie nutzt den Spielraum aus, welcher mit den nicht deterministischen, aber teleologischen Programmen der Kontrolllogik immer einhergeht. Die abgefilmte Performance von Digital TV Dinner (1979) zeigt ein wortwörtliches Herantasten an die Möglichkeiten durch Störungen, die nichts mehr mit den Absichten der Hersteller:innen zu tun haben. Diese Aneignung von zunächst einmal gefundenen, respektive entdeckten Glitches transformiert deren Charakter und macht sie anwendbar – für welche Zwecke auch immer. Insofern ist die Domestizierung ein unumgehbarer Schritt in der Glitch Art, der einerseits zur Popularisierung führt, aber gleichzeitig die kritische und transformative Anwendung erst erlaubt. Ein flüchtiger Moment des Unterbruchs wird zum strategischen Moment in einer Disruption.
Die Live-Performance stellt dabei theoretisch die einzige Möglichkeit dar, dem flüchtigen Charakter des Glitches treu zu werden und gleichzeitig markiert sie genau den Zeitpunkt, in dem er appropriiert wird – ein Moment, auf den statische Endprodukte der Glitch Art immer nur indirekt verweisen können, egal ob ihre Methoden anerkannt oder als simuliert abgestempelt werden. Aber auch in der Performance lässt sich, wie die Anekdote von Per Plaou zeigt, nur schwer etwas Zufälliges planen.
"When my partner Amanda Steggell and I conducted our first internet-fuelled dance performance M@ggie's Love Bytes in 1996, the computers on stage crashed several times and things went extremely bad, technically speaking, but this very fact left the audience in awe, and one critic even spoke about 'the incredible drama created by what seemed like stone-age technology.' It didn't take much to understand that the tension was created by what went wrong, and now what we had rehearsed for months in a dance studio. 'Failure is success' we deducted cleverly, and a couple of years later we deliberately fake-crashed a Mac during a new performance … resulting in a yawning audience. The crash wasn't real and somehow one could subconsciously feel it."[4]
Auch wenn die Performance Glitch Art so den Anschein erwecken könnte, eine letzte Bastion der puren Form des Glitches zu sein, wie sie Moradi in seinem Schema vorschlägt, bleibt trotzdem fragwürdig, wie sehr sie einem ungezähmten Glitch nahekommt, der indirekt auf eine Medienspezifik hinweist. In allen Fällen schreiben sich in den Kontexten der Vermittlung von Glitch Art jedenfalls neue Verbünde und Technologien ein. Wenn wir uns auf die visuelle Seite der Glitch Art konzentrieren, sind es am Ende Bildschirme, Projektionen oder Druckmittel, auf denen die Glitches dargestellt werden. Innerhalb dieser unterscheiden sich die Auflösung, Seitenverhältnisse, Technologien der Bildgenerierung, usw. Es ist diese Vielschichtigkeit, mit der die Glitches auf einen Sachverhalt referieren, der ebenso im Kontext der neuen Medien im Allgemeinen eingeräumt werden kann. Die wilden Störungskaskaden von Wound Footage (2009) zeugen davon. Die Medien der Glitch Art als Hybride zu bezeichnen, verweist auf ihre Besetzung von Zwischenräumen gegenüber modernistischen Vorstellungen von spezifischen, distinkten Medien sowie auf bestimmte Formen, die erst aus der wechselseitigen Beeinflussung dieser hervorgehen. Die diversen angesprochenen Medien werden folglich nicht als eigenbestimmt verstanden, sondern als durch ihre Transfers zu und Aneignungen von anderen Medien und Formaten konstruiert. Wenn also davon die Rede ist, dass Glitch Art auf die Technologien aufmerksam macht, die sie gleichzeitig stört, dann sind damit immer Übersetzungen und Verschaltungen gemeint, die zwischen meist digitaler Prozessierung auf der einen Seite und Aufarbeitung für die Wahrnehmung auf der anderen situiert sind; zwischen Daten und Algorithmen; zwischen Objekt und Prozess: "the fact that a glitched file renders differently when viewed in different applications reminds us that new media exists somewhere in between the files ( collection of 1’s && 0’s ) and the software ( algorithmic processes )."[5]
In der Glitch Art findet eine künstlerische Auseinandersetzung mit Störungen und Fehlern in produzierten Systemen statt. Häufig sind dies jene technischen Systeme, von denen Briz schreibt, zuweilen jedoch auch solche, welche die klare Trennung, die Technik und Digitalität implizieren, gleichwohl wieder aufheben. Die Disruptionen der Glitch Art haben ihrerseits einen vielseitigen Charakter und ermöglichen einen differenzierten Blick auf das, was Störungen und Fehler in programmierten Umgebungen ausmachen. Die Verbindung zwischen Glitch Art und dem, was unter Glitches verstanden wird, ist demzufolge ebenso eine ambivalente und lässt sich besser nachvollziehen, wenn sie als metaphorisch übersetzt und nicht als unmittelbar übernommen gedacht wird.
Mit der Figur der Metapher wird eine Beziehung beschrieben, die von einer Ähnlichkeit bestimmter Teile bei gleichzeitiger Unähnlichkeit anderer Teile geprägt ist. In der Metaphorisierung werden Eigenschaften eines Gegenstands im weitesten Sinne für einen anderen Kontext entlehnt und in der Übersetzung selbst entsteht etwas Neues. Für die Glitch Art beschreibt diese Figur die mannigfaltigen Anwendungen des Glitches in der Verbreitung hin zu weiteren kritischen Ansätzen in einem System, in dem nicht nur die technischen Geräte programmiert sind.
Den Glitch als Metapher zu verstehen reicht jedoch noch weiter als diese Öffnungen auf einer sozialen, gesellschaftlichen Ebene. Auch in der historischen Konstitution der Glitch Art lassen sich diverse Unstimmigkeiten und interne Konflikte des Genres besser verstehen, wenn der Glitch in der Glitch Art metaphorisch gedacht wird. Glitch Art bedient sich folglich nicht bei Glitches im strikten Sinn, sondern eignet sich gewisse Charakteristika dessen an, während andere in der Übersetzung gezwungenermassen verloren gehen. Was dementsprechend auf die diversesten Vorgehensweisen der Glitch Art zutrifft, ist, dass sie Prozesse enthalten, die den Glitch als Metapher für einen Bruch von konventionellen Funktionsweisen einsetzen. Und wenn der Bruch – wie etwa in der Anwendung von Kamerafiltern – nicht die Konventionen von technischer Funktionalität an sich betrifft, so stattdessen möglicherweise diejenigen der bildlichen Repräsentation oder die auf den Körper ausgeweitete Kontrolllogik in programmierten Umgebungen.
Unter diesen Gesichtspunkten findet eine interessante Verschiebung statt, die entgegen den Mythen von technischem Fortschritt und transparenter Kommunikation Authentizität in der Störung findet. Wie bei den Found-Footage-Horrorfilmen spielt es dabei nur eine geringe Rolle, ob die Glitches und das Filmmaterial tatsächlich gefunden oder nachgestellt, beziehungsweise simuliert sind. Als Dokumente gelesen, verfügen sie über einen Charakter von Unabgeschlossenheit, welcher durch die Subversion der zu erwartenden Konventionen von optimaler Kommunikation entsteht. In der Verschiebung von der Suche nach der Wahrheit hin zu der Suche nach den Bedingungen, die Wahrheit konstruieren, übernimmt die Störung, die auf die Konstruiertheit verweist, folglich eine ehrlichere Position. Eine im weitesten Sinne transparente Technologie, die Natürlichkeit und Neutralität suggeriert, ist über die als richtig erachtete Funktionsweise und die Affordanz nicht weniger mit latenten Implikationen diverser Art geladen. Während die reguläre Nutzung diese reproduziert, repräsentiert Glitch Art einen Weg, sie an die Oberfläche zu bringen.
Was Glitches demnach vermögen aufzuzeigen, sind nicht unbedingt die verborgenen, diffusen Strukturen, welche technologische Kommunikation ausmachen und dabei Dichotomien, wie virtuell-real oder Mann-Frau reproduzieren. Sie verweist aber auf die Prozesse, durch welche diese Strukturen als naturalisiert und neutral konstruiert werden, während sie effektiv kontingent und äußerst parteiisch sind. Vom Ende her gedacht wird diese Distinktion so oder so schnell unscharf. Glitch Art kann demzufolge nicht als Alleinlösung revolutionär sein oder – wie es ab und zu behauptet wird – einen Einblick in die Beschaffenheit der gegenwärtigen Kommunikationstechnologien garantieren. Aber sie setzt einen Ausgangspunkt, einen Funken. Selbst wenn eine Glitch Art Praxis nur Simulationen von Sabotage darstellt, kündigt sie trotzdem noch lauthals die hegemonialen Strukturen innerhalb digitaler Repräsentationen an.[6] Die Glitch Art wird unter diesen Gesichtspunkten eine zuerst investigative und dann interventive Strategie der Wiederaneignung der Spielräume. Sie zeigt sowohl die Kontingenz und Konventionalität in Kontrollumgebungen auf, die als Funktionalität getarnt sind und ermöglicht dadurch Strategien der Verweigerung und Taktiken der Nonexistenz gegenüber einem System, in dem Erwartbarkeit die Bedingung für Manipulation ist.[7] "Useless, we disappear, ghosting on the binary body."[8]
Es könnte in Folge dieser Argumente behauptet werden, dass die Glitch Art immer eine aktivistische, wenn nicht sogar revolutionäre Seite hat, insofern als dass sie sich gegen die Leitideologie der Kommunikationstechnologien richtet, in welcher es erstens immer weiter und immer weiter nach vorne geht und zweitens das große Ziel ist, als wie weniger wahrnehmbare Kanäle zu konzipieren und zu produzieren: absolute Rauschreduktion neben endloser Produktionssteigerung. Im Erfolg der Glitch Art einhergehend mit der Medien- und Techniknostalgie, ist in all dem eine letzte, für die Glitch Art maßgebliche Situation erkennbar. Es handelt sich dabei um die wechselseitige Umkehrung in der Deutung von technischen Störelementen, oder schlicht und einfach die logische Abwechslung – Dialektik, wenn man so möchte – von Enteignung und Wiederaneignung der systemischen, ideologischen Bewertung von Fehlern in einem spätkapitalistischen Modell.
Auf der einen Seite ist darin die ernüchternde Erkenntnis enthalten, dass sich die Bewegungen immer nur wiederholen, auf der anderen Seite die Realisation, dass es immer weiter geht. Glitch Art nährt sich von diesem Spannungsverhältnis, welches sie zwischen einer teils zynisch rückblickenden Nostalgie mit repetitiven Vorgehensweisen und einem in die Zukunft gerichteten hoffnungsvollen Unbekannten mit explorativen und spekulativen Ideen situiert – zwischen Rekursion und Revolution.
[1] Briz, Nick. Glitch Art Historie[s]. 2011. http://nickbriz.com/files/glitchresearch/GlitchArtHistories2011.pdf (Stand: 17.02.2023). [2] Betancourt, 2017: S. 12. [3] Temkin & Manon, 2011: S. 1. [4] Platou, 2009: S. 6. [5] Briz, Nick. Thoughts on Glitch[Art]v.2.0. 2015. http://nickbriz.com/thoughtsonglitchart/thoughtsonglitchartv2.0.pdf (Stand: 17.02.2023). [6] Vgl. Temkin & Manon, 2011: S. 6. [7] Vgl. Scott, 1998: S. 183. [8] Russel, 2020: S. 68.