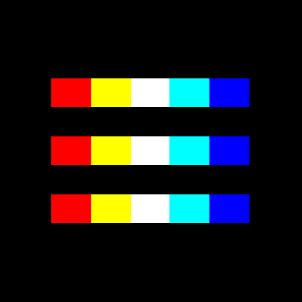5.2. Beyond Glitch
- Marinus Börlin
- 31. Jan. 2023
- 14 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023
"All technology reflects the society that produces it, including its power structures and prejudices. This is true all the way down to the level of the algorithm."[1]
In diesem letzten Kapitel möchte ich die anderorts gemachten Punkte aufgreifen, aber anstatt einer Zusammenfassung eine Analyse und Theorie formulieren, die noch einmal einen Schritt weiter geht. Es handelt sich dabei um einen Erklärungsansatz für den Erfolg von Glitch Art, der paradoxerweise mit deren Auflösung argumentiert und den Glitch in der Glitch Art abstrahiert. Diese Argumentation folgt aus der Beobachtung einer doppelten Öffnung, die jedoch zwei sich nicht in jeder Hinsicht deckende Richtungen markiert: Der gleichzeitigen Transformation der Glitch Art von einer subkulturellen Gegenbewegung in eine kommerzielle Ästhetik einerseits und von einer technischen mehr oder weniger definierten Prozedur der Störung in eine Metapher des Widerstands andererseits. Durch diese beiden Tendenzen findet eine Spaltung der Glitch Art statt in eine Glitch Ästhetik und eine Glitch Ideologie, welche beide im Genre von Glitch Art vereint werden, wodurch sie sich entweder weiter gegenseitig befruchten, das Genre spalten oder die eine Seite die andere schluckt. Die Konsequenz von letzterem wäre, dass entweder die Glitch Ästhetik komplett von einem kritischen, ideologischen Aspekt getrennt wird – was viele Glitch Artists und - Forscher:innen schon lange befürchten – oder dass die Figur des Glitches so stark abstrahiert wird, dass jede Form von Intervention und Rebellion in gegenwärtigen, von Programmierung durchdrungenen Netzwerkgesellschaften als Glitch gesehen werden kann und folglich jede diesbezüglich künstlerische Herangehensweise als Glitch Art. Die Undefinierbarkeit und Fluidität des Glitch Begriffs offenbart sich hier als zweischneidiges Schwert. Des Weiteren stehen die folgenden Erklärungsansätze unter dem Zeichen einer "nach-revolutionären Ernüchterung"[2] bezüglich des Digitalen, die Cascone bereits vor über 20 Jahren vom "Post-Digitalen" schreiben liess.[3] Ich argumentiere demzufolge mit der Annahme einer verbreiteten Skepsis gegenüber dem Sammelbecken des Digitalen, ausgelöst durch Diskurse von Ausbeutung, Überwachung, Datenschutz, Täuschung und Manipulation. Die Entwicklung der Glitch Art selbst ist geprägt von diesem Wandel einer Technikeuphorie des frühen Internets und verbreiteten Personal Computers hin zu einer Erkenntnis der negativen Potentiale und Konsequenzen von Sozialen Medien und fotografischer Selbstinszenierung, Überwachungs- und Plattformkapitalismus, geplanter Obsoleszenz, usw.
Glitch Art gegen […]
Die Glitch Art agiert, wie ich den anderen Kapiteln zeige, innerhalb verschiedener Kontexte und wird durch diese bestimmt, sowie bestärkt. Sie ist jedoch auch eine Reaktion auf unterschiedliche Kontexte, insofern als dass sie Gegenpole einnimmt und als durch die ihr gegenüber gestellten Phänomene hervorgebracht verstanden werden kann. Als Störungsprozess in der Produktion und Störungsästhetik im Endprodukt richtet sich Glitch Art, so das Argument, immer gegen etwas: Gegen die scheinbare Ordnung des Bildes,[4] gegen konventionelle, vordefinierte Flüsse von Information,[5] gegen die Vorstellung von Normativität durch Funktionalität, Schönheit und Homogenität.[6] Sie speist sich dabei vom quasi- paradoxen Verhältnis zwischen dem Bewusstsein einer Abhängigkeit von Systemen und deren Ablehnung auf der einen Seite und der Furcht dass diese Systeme versagen auf der anderen.
So argumentiere ich hier, dass die Verbreitung von Glitch Art eine Gegenbewegung darstellt, welche drei grosse aktuelle Narrative und die in ihnen enthaltenen Spannungsverhältnisse angeht. Das ist erstens die Vorstellung der Transparenz von Medien, zweitens die Form der Kontrolle und Programmierung in Netzwerkgesellschaften und drittens die Konstruktionen von Identitäten, welche durch die ersten beiden Narrative produziert und reproduziert werden. In allen drei Bereichen emergiert die Glitch Art als Gegenstrategie, die von der Verbreitung der drei Narrative parasitär mitprofitiert, während sie gleichzeitig durch sie gespiesen eine Öffnung erfährt, worin der Glitch zur Metapher wird. Dadurch ist das revolutionäre an Glitch Art nicht mehr die Subversion der Technologie, sondern die Anwendung der technischen Logik auf die Gesellschaft und die Wiederaneignung dieser Übersetzungen.
[…] Transparenz
"Erst wenn dieser Strom von Selbstverständlichkeit gestört wird, stehen wir staunend vor diesem Wunder."[7]
Die Diskurse der Glitch Art hängen über diverse Verbindungen mit der erfolgreichen und verbreiteten Vorstellung einer Transparenz der Medien zusammen, anhand welcher die Bedingungen der jeweiligen Medienfunktion gegenüber den vermittelten Inhalten verdeckt werden. Diese Transparenz lässt sich anhand zweier Annahmen erklären, gegen die sich die Glitch Art richtet: Erstens, dass Medien wahrnehmbar machen, während sie sich gleichzeitig der Wahrnehmung entziehen; und zweitens, dass die Kommunikationstechnologien Wahrnehmung binär strukturieren, indem sie diese als richtig oder falsch einordnen. Die beiden Annahmen sind in diesem Kontext untrennbar miteinander verbunden. So ist im Ziel einer theoretisch perfekten Kommunikation nicht mehr möglich zu erkennen, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat und wie sie konstruiert ist. In derselben Logik ist alles, was zur Annäherung an dieses Ziel beiträgt eine korrekte, wahrheitsgetreue Wahrnehmung und alles, was dem entgegen verläuft, was also als Störung auf die Konstruiertheit der Kommunikation verweist, eine falsche, wahrheitsuntreue.
Das Verhältnis von Transparenz und Selbstreferentialität der Medien – was Bolter & Grusin mit Immediacy und Hypermediacy bezeichnen – hat in Kunst und Wissenschaft eine lange und ausführliche Geschichte.[8] Ein prominentes Beispiel, das für die Glitch Art äußerst relevant ist, ist die Fenstermetapher,[9] in welcher "die Vorstellung des materiellen Bildträgers vollkommen durch die Vorstellung einer durchsichtigen Ebene verdrängt wird".[10] Wie Siegert schreibt, ist es Leon Batista Alberti, auf den diese Denkfigur zurückgeht. Dieser definierte in De pictura im Jahr 1435 "die Bildebene als Schnitt durch die Sehpyramide […] und [verglich] die so definierte Bildebene mit einem offenen Fenster,"[11] wobei dieses Fenster höchstwahrscheinliche bereits da metaphorisch gedacht war.[12]
Im Kontext der Informationstheorie und auf den Begriff des Noise und die Reduktion des Signal-Rausch-Abstands bezogen, erhält die Transparenz der visuellen Medien und Sichtbarkeitsordnungen ein weiteres Momentum hin zu dem, was als modernistisches ideal für Kommunikationstechnologie ab dem 20. Jahrhundert bezeichnet werden kann: Der Vorstellung eines optimierten, transparenten Kanals. Dass dieses Optimal nie erreicht werden kann, hält dabei nicht vom Streben ab, so nahe wie möglich an das Ziel heranzukommen.[13] Indem Kommunikationstechnologien den Fokus auf die Optimierung von Transparenz legen, wird in Folge nicht nur das Bewusstsein gegenüber Noise vermindert, sondern, wie Kane argumentiert, mehr und mehr von der Fähigkeit verloren, dessen einhergehend ansteigendes Wachstum zu erkennen.[14] Dabei ist es nicht abzustreiten, wie effektiv die Technologien ihr Rauschen verdecken, so dass die sinnliche Wahrnehmung der Menschen nicht mehr das einzige Mittel sein kann, um diese zu erkennen, zumindest nicht ohne den Hintergrund einer kritischen Medienästhetik, welche gerade durch den Glitch entfacht werden kann.
Entgegen diesem Mythos von Durchsichtigkeit[15] zeigt Glitch Art auf, dass die Kommunikation nicht von ihrer Materialität losgelöst werden kann, auch wenn theoretische Modelle dies nahelegen und die menschlichen Sinne nicht in jedem Fall als Zeugen des Gegenteils auftreten können. "The noiseless channel doesn't exist.", schreibt Menkman, "What makes every medium specific is how it fails to reach a state of complete transparent immediacy."[16]
Die Glitch Art greift dabei nicht nur in die Vorstellung von Transparenz in einer Fenstermetapher ein, indem sie darin Fehler produziert, welche die vermeintliche Durchlässigkeit zu einem Raum dahinter stören. Ihre Störelemente und -momente sind explizit flach, wie es auch die Repräsentation des dreidimensionalen Raums in den verbreitetsten visuellen Medien ist. Untitled Game von JODI zeugt als extremes Beispiel von dieser Tatsache. Die Formen und Ausdrücke der Glitch Art sind in anderen Worten aufgrund ihrer strukturellen Beschaffenheit, die nicht auf die Wahrnehmbarkeit durch das menschliche Auge abzielt, frei von der immer noch stark vorherrschenden Logik der Zentralperspektive, welche mit der Transparenz im visuellen Bereich untrennbar zusammenhängt. Über diesen Weg wird nicht zuletzt argumentiert, wenn die Glitch Art in eine Linie mit Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts gesetzt wird, die Sichtbarkeitsordnungen als kontingent und konstruiert entlarven. Dieser Aufbruch der Perspektive anfangs des 20. Jahrhunderts wird häufig mit dem Einzug der Technologie und mit den Traumata des Kriegs erklärt.[17]
Die Transparenz, in welcher die vermittelnden Medien verschwinden sollen, ist demzufolge nicht nur das Ziel einer Technologieentwicklung, welche diese an den Fortschrittsgedanken koppelt. Sie steht metaphorisch ebenso für die Funktionalität auf einer generelleren Ebene, wo sie hegemoniale Normativität kennzeichnet und konstituiert. Und im Film beispielsweise bezeichnet die durchsichtige Oberfläche regelmässig eine normale Wahrnehmung. Filmeffekte, die auf die Kamera und die Leinwand aufmerksam machen, hingegen eine Störung, bei der eine technische, ästhetische Abweichung für eine Abnormalität in der geistigen Verfassung einsteht. "[T]ransparency is mental balance, while hypermediacy is mental dysfunction"[18]. Die Verwendung von Glitch Art und Glitch Art Effekten in populärkulturellen Erzeugnissen spielt oft in diese Schiene hinein.

Dass Kommunikationstechnologien die Wahrnehmung ordnen und diese als wahr oder verfälscht, korrekt oder inkorrekt konstruieren, hat dabei eine hinter der offensichtlich wertenden Seite eine latente, strategische. Das als falsch konstituierte soll ausgeschlossen werden; zuerst aus dem technischen System und dann aus der Kultur und der menschlichen Erfahrung.[19] Diese essentialistische Vorstellung von Wahrnehmung unterminiert dabei die Tatsache, dass die Wahrnehmungen von Störungen nicht per se falsche Wahrnehmungen sind, sondern vielmehr ungewünschte. Es handelt sich um Wahrnehmungen der Bedingungen ihrer selbst – eine Wahrnehmung zweiter Ordnung – die immer die Frage aufkommen lassen müsste "Wer profitiert und wer verliert?".
Glitch bricht das auf, was die eigenen Produktionsbedingungen versteckt, um sich selbst diesen gegenüber nicht verantworten zu müssen. Wenn technische Bilder nicht nur eine objektive Wahrheitsvermittlung suggerieren, sondern auch ihre eigenen Existenzbedingungen erkennbar werden, entsteht eine Angriffsstelle gegen solche Formen der Macht, die über Wahrheitsproduktion operieren, indem sie sich als neutral und natürlich ausgeben. Wo die Glitch Art also die Illusion der Transparenz aushebelt, hat das weiterreichende Konsequenzen als die Zerstörung einer konstruierten, technischen Sichtbarkeit. Die Transparenz von Bildern ist nämlich nicht diejenige eines offenen Fensters, denn sie lässt den Durchblick nur von einer Seite zu. Mit der Dekonstruktion dieser hierarchischen Raumtrennung durch den Eingriff in der Glitch Art Praxis wird nichts weniger als die Rolle der unbeteiligten Beobachtenden aufgegeben und damit einhergehend der transzendentale "Platz der res cogitans".[20] Wer Glitch Art praktiziert, ist nicht mehr Beobachter:in, sondern Beteiligte:r im strategischen Spiel der Sichtbarkeit durch technische Medien und übernimmt damit Verantwortung. Wenn Olivier schreibt, dass der Glitch "the semi-opaque counterpart to the terror of transparent vision"[21] ist, dann wird nun klar sein, dass diese Sicht nur voller Terror ist, weil diejenigen, für die sie transparent ist, von ihrer Logik ausgeschlossen sind. Geister fürchten sich nur selten vor anderen Geistern.
[…] Kontrolle
Indem Glitch Art die Bedingtheit der Kommunikation aufzeigt und den Mythos der absoluten Transparenz sprengt, wird gleichzeitig der komplette Ausschluss im Mythos der Kontrolle entlarvt, in welchem Absicht und Programmierung nicht mehr voneinander zu unterscheiden wären. Unter dem Zeichen der Transparenz geht die Glitch Art auf die Spannung ein, zwischen einer Vorstellung von nicht wahrnehmbaren Medien und einer Welt, die als wie mehr von technischen Kommunikationsmitteln durchdrungen ist. Bezüglich der Figur der Kontrolle positioniere ich die Glitch Art an der Unvereinbarkeit von postulierter Freiheit in gleichzeitig programmierten Umgebungen. "'control' describes that set of actions that directs behavior toward intended outcomes."[22] schreibt Nunes und übernimmt dabei semantisch die Sanftheit, mit der Kontrollsysteme vorgeben zu wirken, wenn sie ihre radikalen Konsequenzen hinter Begriffen wie Nudging und Libertärer Paternalismus verstecken.[23]
In seinem Postskriptum über die Kontrollgesellschaften skizziert Deleuze das Gesellschaftssystem der Kontrolle in Kontrast und als Fortsetzung zu demjenigen der Disziplin, wie es ausführlich von Michel Foucault beschrieben wurde.[24] Während letztere auf der Logik von geschlossenen, einschliessenden Systemen, der Verteilung im Raum und der Anordnung in der Zeit aufbauen,[25] funktioniert die Kontrollgesellschaft entlang von Modellen der Modulation und Variation. In der Kontrollgesellschaft schiftet nach Deleuze die Organisation weg von Einschränkung und Einschluss hin zu einer scheinbar endlosen Erweiterung von kontrollierter Mobilität.[26] Die Kontrolle beschreibt dabei eine Logik, die massgeblich mit der Programmierbarkeit von elektronischen Systemen und Computern zusammenhängt. Ihr Ziel als Regierungsform ist nicht mehr Fehlverhalten durch Bestrafung zu verhindern, sondern es von Beginn an durch die Konstruktion der Bedingungen der Möglichkeiten auszuschliessen. Die Glitch Art setzt bei diesem Ausschluss an, indem sie die Überreste im Potential zwischen der Absicht und der Kontrolle ausnutzt. Die untrennbare Verbindung zwischen Absicht und Kontrolle[27] und die Rolle, welche der Fehler dabei spielt, ist Existenzbedingung dafür das der Glitch in einem Gesellschaftsmodell entsteht und wuchert, welches zu einem grossen Teil unter dem Modus der Kontrolle operiert. Die Kontrollsysteme beziehen dabei Fehler im Sinne von Abweichungen vom vorbestimmten Ziel mit ein, indem sie diese in einer Feedbacklogik zur Anpassung der Kontrolle hin zum erwarteten Ziel selbst verwenden. "Error is tolerable to the degree that deviation remains systematically contained within a program of control."[28] Das schliesst jedoch nicht aus, dass es auch Fehler gibt, die sich einer solchen Produktiv-Machung entziehen. Diese Fehler – wie ich sie beispielsweise im Kapitel zu Glitches in Computergames differenziere – versucht die Glitch Art einzusetzen und zu adaptieren. Sie stellen die Form von Störung dar, welche Deleuze als passive Gefahr für die Maschinen der dritten Art bezeichnet, durch welche Kontrollgesellschaften operieren, Informationsmaschinen und Computer. Ihnen gegenüber stehen die aktiven Gefahren der Hacker und Viren,[29] welche der Glitch Art nicht weniger verbunden sind. Dass die Störungen hier als passive Gefahren bezeichnet werden, ist das gleiche Argument, wie dass sie nicht von aussen kommen und dass sie mit der Produktion der Systeme bereits miterfunden werden.
Indem die Glitch Art die Fehler in Kontrollsystemen nutzt, die nicht bereits in deren Funktionsweise vorgesehen sind, stellt sie einen Prozess des Unproduktiv-Machens dar, der weder mit Selbstausschluss, respektive Boykott, noch mit absoluter Zerstörung zusammenhängt. Der Glitch kommt aus dem System selbst und zeigt dessen Potential über die vorgegebene Verwendungsweise hinaus. Damit hängt die Glitch Art über ihre Strategie mit dem zusammen, was Galloway & Thacker als "Tactics of Nonexistence"[30] bezeichnen. In diesen geht es darum, Techniken und Technologien zu entwickeln, die einem erlauben, sich der Ausweisbarkeit zu entziehen ("to make oneself unaccounted for"[31]), die Lücken und Schwachstellen von Kontrollsystemen zu entlarven, um ihren beabsichtigen Vereinnahmungen zu entkommen, mit denen immer kategorische Zuschreibungen verbunden sind. "It is an exploit."[32]
Wie die Akteur:innen in den Tactics of Nonexistence durch Unzuschreibbarkeit non-existent werden, so der Glitch in der Glitch Art. Zwischen den erwarteten Verwendungen einer Technologie und der Ausnutzung ihrer unerwarteten, möglichen Verwendungen entziehen sich beide der binären Klassifikation. Dieses Projekts, wie es Franklin formuliert, deutet folglich auch auf die Öffnung von Glitch Art als metaphorisches Unterfangen hin: "The value of this project lies less in the specific tasks that programming allows, and more in the value of reclaiming a breadth or freedom of use from, or programming, technologies designed to work in only one, directed way."[33]
Wenn der Ansicht folge getragen wird, dass in der Kontrollgesellschaft die Logik von Kontrolle, Programmierung und Code jegliche Aspekte der Gesellschaft und des Lebens bestimmten, dann überrascht es auch nicht, dass die Logik von Glitch ebenso übertragbar wird, wodurch die Figur der Glitch Artists einer sehr ähnlichen Verallgemeinerung folgt, wie zuvor diejenige des Hackers. "McKenzie Wark, in A Hacker Manifesto, expands the role of the hacker from electrical engineering and computation to all cultural and technical fields where information is processed and turned to new applications."[34]
Dort wo sie zu einer Entität werden, die frei von im System repräsentierbaren oder vorhergesehenen Kategorien sind, fallen die Figur des Glitches und die Figur des/r Glitch Artists zusammen. Eine nicht eindeutig identifizierbare Entität kann im System der Kontrolle nicht produktiv gewendet werden und ist irrelevant. Die Praxis der Glitch Art im Einzelnen (und damit meine ich nicht nur die Glitch Produktion) ist gleichzeitig selbst ein Glitch im viel grösser System der Kontrollgesellschaft, indem immer neue Wege erdacht werden, wie sich der Identifizierung und Produktiv-Machung entzogen werden kann. Und selbst wenn nicht jeder Akt von Glitch Art eine Neueröffnung in dieser Hinsicht darstellt, so verweisen sie nichtsdestotrotz auf die Möglichkeit hin zur Öffnung; auf die Überreste im Potential.
Dies bringt mich zum letzten breiteren Kontext. Wie die beiden vorherigen ist dieser gleichzeitig durch seine inhärenten Spannungen mitverantwortlich für die Verbreitung und Abstrahierung der Glitch Art und das, wogegen sie sich stellt. Es handelt sich um die unhaltbare Figur einer stabilen Identität, wie sie etwa Frieling in Muratas Monster Movie durch die Glitches entkoppelt sieht.
[…] Identifizierung und Körper
Im Übergang der Glitch Art von einem exklusiven, technischen Stil der Störung in eine metaphorische Figur stecken weitreichende Implikationen. Eine der wohl wichtigsten ist die Aufhebung der Trennung zwischen einem technologischen, programmierten Raum des Digitalen und einem realen, belebten, analogen Raum der Körper, die sich nur an Schnittstellen begegnen. Diese Separation, spiegelt, sowie impliziert weitere Dichotomien und spannt gleichzeitig den Bogen zwischen sehr frühen und ganz aktuellen Auswüchsen der Glitch Art. Schon so früh wie 1995 experimentierten beispielsweise Amanda Stegell und Per Platou von Motherboard über die Figur M@ggie mit dem nahtlosen Übergang zwischen digitalen und physischen Selbsten,[35] Online- und Offline-Personae.[36]
Motherboard. M@ggie, Introduction. 1999.
In deren Tanzperformance M@ggie's Love Bytes (1996) vereinten sie physikalischen und virtuellen Raum, Sound, Text und Live-Videokonferenz, mit all den Unsicherheiten, die diese Assemblage mit sich bringt. "The performance is carefully planned to take on the unpredictability of cyberspace; improvisation is of essence! Computers inevitably crash, connections break. The restrictions and malfunctions of the technology are used creatively."[37]
Über fünfzehn Jahre später verwendet Legacy Russell den Begriff Glitch für ein neues intersektionales Kapitel von Cyberfeminismus, worin die Verbindung von Gender, Identität und gegenwärtigen Kommunikationstechnologien behandelt wird. Wo der digitale Dualismus, in dem sie Nathan Jurgenson folgend IRL auf AFK überträgt ("in real life" auf "away from keyboard"),[38] suggeriert, dass es zwei voneinander isolierte Selbste gibt, bricht der Glitch nach Russell diese Differenz auf und verbindet die beiden Seiten:
"When watching media online, it is the rainbowed spinning wheel, the pixilated hiccup, the frozen screen, or the buffering signal that acts as a fissure, that jars us into recognition of the separation of our physical selves from the body that immerses itself in fantasy when participating in sexual activity online. Yet, simultaneously, it is also the glitch that prompts us to 'choose-our-own-adventure, to finish the story, and, in doing so, to acknowledge that when the mediation of digital space fails us, albeit briefly, we continue right where we left off, taking the revolution offline, but not out of body, thereby demonstrating the fallacy of the digital dualist dialectic."[39]
In Zeiten von Big Data und algorithmischen Identitäten, in denen jede/r User:in unzählige, ihnen nicht zugängige Profile produziert, die ein variiertes und ambivalentes Online-Verhalten auf Listen binärer Oppositionen von Identitätszuschreibungen reduziert, erhält der Glitch als Strategie der Verweigerung eine neue Schlagkraft. Und es wird ersichtlich, wie wichtig und relevant er auch bezüglich der Konstruktion von Identitäten und der Einschreibung des Körper wird. Die "new algorithmic identity", wie sie Cheney-Lippold nennt, setzt auf statistische Modelle um den User:innen automatisch Kategorien von Geschlecht, Klasse, Ethnie, usw. zuzuordnen, während es gleichzeitig deren Bedeutung und Folgen definiert.[40] Die Daten, die Computer verarbeiten, mögen auf der Ebene der Prozessierung und im theoretischen Modell der Kommunikation zwar frei von Bedeutung sein, sie erhalten durch Kontextualisierung und Verschaltung jedoch sehr wohl wieder einen Sinn zugeschrieben, der gerade bezüglich der Identifizierung weitreichende Folgen über eine Separation von online und AFK hinaus hat:
"A new value like X = male can then be used to suggest sorting exercises, like targeted content and advertisements, based entirely on assumptions around that value. Yet code can also construct meaning. While it can name X as male, it can also develop what 'male' may come to be defined as online. But this new value is not corralled within an entirely digital realm."[41]
Wenn folglich das Online-Verhalten eines/r Users:in mit der Kategorie "male" identifiziert wird, werden in einer kybernetischen Feedback-Logik die Inhalte, welche dieser Person vorgeschlagen werden, angepasst an das, wovon bestimmt wurde, dass es mit Männlichkeit zusammenhängt, während gleichzeitig diese Kategorie durch die Aktivitäten des/r User:in mitgeformt werden. Hier wird ersichtlich, wie untrennbar diese Identifizierungen mit der Kontrolllogik zusammenhängen und diese beschützt werden, indem ihre Funktionsweisen in einer simulierten Objektivität der Transparenz untergehen. Die neue algorithmische Identität funktioniert nicht über fixierte normative Diskurse oder Disziplinarmacht, sondern modular und regulativ. Sie konfiguriert Leben und Körper durch die Anfertigung der Bedingungen des Möglichen.[42] Wie genau diese algorithmischen Logiken folglich Dichotomien und Stereotypen reproduzieren, zeigen Studien wie Algorithms of Oppression von Safiya Umoja Noble deutlich auf.[43] Wie die iterativen Identifizierungsstrategien reproduzieren die Suchmaschinenalgorithmen nach Noble bestimmte Narrative, die historisch ungleiche Verteilungen von Macht in der Gesellschaft reflektieren.[44] Im Spannungsverhältnis, welches daraus entsteht, dass Menschen auf der einen Seite in einem kontinuierlichen Austausch mit Codierung und Programmierung identifiziert werden, während gleichzeitig "das Menschliche" durch Transparentmachung der Bedingungen als separat von technischer Konstitution vermittelt wird, findet die Glitch Art eine Chance in der Verfremdung und eine Produktivität in der Unproduktivität der Störung.
In Legacy Russels Worten: "an error in a social system that has already been disturbed by economic, racial, social, sexual, and cultural stratification and the imperialist wrecking-ball of globalization – processes that continue to enact violence on all bodies – may not, in fact, be an error at all, but rather a much-needed erratum. This glitch is a correction to the 'machine', and, in turn, a positive departure."[45]
Russel beschreibt hier die Rolle, die Glitches einnehmen können, indem sie differenzieren lassen zwischen einem Fehler, der die Funktionalität eines Systems unterbricht und einer Störung, welche die Intentionalität aufdeckt und ermöglicht, die Funktionsweise zu reorganisieren. Insofern als dass Glitch Art schon immer versucht programmierte Systeme und die in ihnen verankerten Konventionen zu reorganisieren, ist es keine grosse Überraschung, dass sie auf den Körper übertragen wird, der über die Identifizierung mitunter zu den am stärksten programmierten Systemen gehört. Wo Transparenz, Kontrolle und Identifizierung noch die persönlichsten Aspekte durch Programmierung strukturiert, eignet sich die Glitch Art diese so wieder zurück an, um festgeschriebene Systeme aufzubrechen. Nicht um zurückzugehen, in ein fiktives davor, sondern um Alternativen in dem zu zeigen das es gibt und dadurch zu erkunden, wohin es weitergehen könnte.
[1] Russell, 2020: S. 23. [2] Sollfrank, 2015: S. 299. [3] Vgl. Cascone, 2000. [4] Vgl. Kane, 2019. [5] Vgl. Menkman, 2011b. [6] Vgl. Russel, 2020. [7] Von Foerster, 1990: S. 441. [8] Vgl. Bolter & Grusin, 2000: S. 20 ff. [9] Für eine ausführliche Abhandlung, Kritik und Fortsetzung dieser Metapher vgl. Friedberg, 2006. [10] Panofsky, 1998: S. 127, Fussnote 5. [11] Siegert, 2005: S. 105. [12] Vgl. Friedberg, 2006: S. 30 ff. [13] Vgl. Menkman, 2011b: S. 14. [14] Vgl. Kane, 2019: S. 12. [15] Ebd.: S. 9. [16] Menkman, 2011b: S. 65. [17] Lotringer & Virilio, 2005: S. 14 ff. [18] Bolter & Grusin, 2000: S. 152. [19] Vgl. Kane, 2019: S. 12. [20] Vgl. Siegert, 2005: S. 105. [21] Olivier, 2015: S. 259. [22] Nunes, 2011: S. 6. [23] Vgl. Thaler & Sunstein, 2008. [24] Vgl. Deleuze, 1993. [25] Vgl. ebd.: S. 254. [26] Vgl. Galloway, 2006: S. 87. [27] Vgl. Nunes, 2011: S. 6. [28] Ebd.: S. 7. [29] Vgl. Deleuze, 1993: S. 259. [30] Galloway & Thacker, 2007: S. 136 ff. [31] Ebd.: S. 136. [32]Ebd.: S. 136. [33] Franklin, 2009. [34] Ebd. [35] Die Deutsche Sprache ist hier radikaler, wie die Englische, da sie den Plural von Selbst nicht kennt. [36] Vgl. Motherboard. M@ggie's Love Bytes. WhatWhereHowWhoWhyNow. 1999. http://www.liveart.org/motherboard/MLB/why.html (Stand: 17.02.2023). [37] Ebd. [38] Russel, Legacy. Digital Dualism and the Glitch Feminism Manifesto. (The Society Pages). 2012. https://thesocietypages.org/cyborgology/2012/12/10/digital-dualism-and-the-glitch-feminism-manifesto/ (Stand: 17.02.2023). [39] Ebd. [40] Vgl. Cheney-Lippold, 2011: S. 165. [41] Ebd.: S. 167. [42] Vgl. ebd.: S. 169. [43] Vgl. Noble, 2018. [44] Vgl. ebd.: S. 71. [45] Russel, Legacy. Digital Dualism and the Glitch Feminism Manifesto. (The Society Pages). 2012. https://thesocietypages.org/cyborgology/2012/12/10/digital-dualism-and-the-glitch-feminism-manifesto/ (Stand: 17.02.2023).