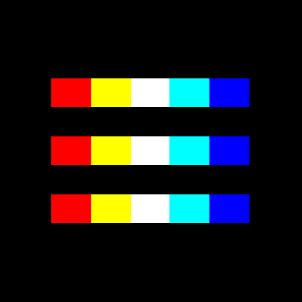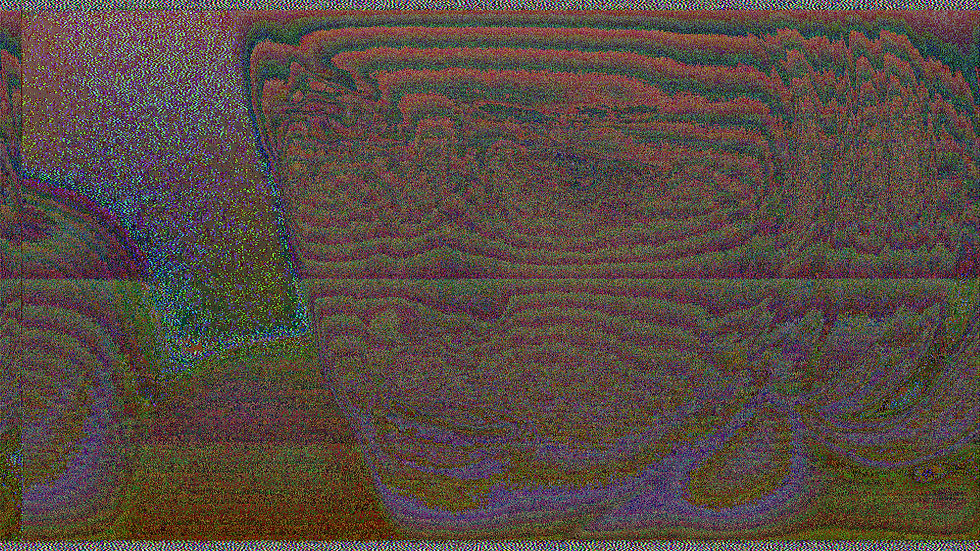4.2.2. Monster Movie (2005)
- Marinus Börlin
- 8. Feb. 2023
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023

Murata, Takeshi. Monster Movie. 2005. Screenshot. Zum Video (Stand: 17.02.2023)
Es ist fraglich, inwiefern die Diskurse der Glitch Art in die Argumente von Medienhybridität hineinspielen, ob sie diese bestätigen, indem Verschaltung und Übertragung beliebiger Medien als Mittel zur Glitch-Erzeugung verwendet werden, oder ob sie nicht die alten Medienvorstellungen rettet, aber die Form der Darlegung auf neue Technologien überträgt. Das wären nicht mehr nach den Sinnen geordnete Analogmedien, sondern eben gerade die angesprochenen Verschaltungen und Übertragungen, die nicht einfach nur Zahlen verlustfrei in andere Zahlen übersetzen, sondern durch Codecs und Ein- respektive Ausgabegeräte immer noch ihre eigenen Kanäle mitschreiben. Anhand von Takeshi Muratas Monster Movie von 2005 lässt sich eine Vielzahl solcher Spezifika erkennen und erläutern.[1] Die Glitch-Methode, welche Murata bei Monster Movie (2005) angewendet hat, nennt sich Datamoshing und zählt heute wohl zu einer der bekanntesten hinsichtlich ihrer Artefakte. Der TikTok Account connection_intercepted,[2] welcher zum Zeitpunkt dieser Arbeit 5.4 Millionen Follower und 116.5 Millionen Likes verzeichnet, publiziert beinahe ausschliesslich Videos, die höchstwahrscheinlich mit einem DataMosh-Filter produziert wurden und sich dieser Glitch Ästhetik bedienen. Sein Erfolgsrezept liegt dabei nicht etwa in der experimentellen Glitch Produktion und technischen Erkundung der Störung. Vielmehr gewichtet er die Herstellung und Auswahl von äusserst geeignetem Bildmaterial, welches den Effekt als Mittel zum von Glitch Artefakten begleiteten Datamosh-Match Cut nutzt.
Connection Intercepted Trippy TikTok Video Compilation (HD). Connection Intercepted. 2021.
Dass die Auswahl des Bildmaterials beim Datamoshing nicht nur in Bezug auf die Schnitte relevant sind, sondern auch auf die Bewegungen im Bild vor und nach dem Schnitt, zeigt ebenso Muratas Monster Movie (2005). Die Erklärung dafür steckt in der technologischen Vorgehensweise der Glitch Strategie und den Objekten dieses Vorgehens, welche Videos sind, die nach einem bestimmten Kompressionsverfahren codiert wurden. Daher leitet sich die ab und zu verwendete Bezeichnung "compression aesthetics"[3] ab. Die Datamosh Glitches nutzen die Formatierung bestimmter Videocodecs aus, welche die Frames in unterschiedliche Typen sortieren, um die Menge an Daten, die für die Speicherung verwendet werden müssen, zu reduzieren.[4] Die Frames, welche in einem unkomprimierten (RAW) Video allesamt gänzlich auf Einzelpixel basierende Bilder darstellen, werden hier in i-, p- und b-Frames aufgeteilt. In den i-Frames ("intra-coded picture"), auch bekannt als Reference- oder Key Frames, werden dabei ganze Bilder abgespeichert mit Werten bezüglich Helligkeit und Farbe, wobei diese auch bereits Kompressionen mit Macroblocks enthalten können, wie es beispielsweise bei einem JPEG-Bild der Fall ist.[5] In den p- und b-Frames ("predictive-coded frame" und "bidirectional-coded frame") wird hingegen nur Information gespeichert, die eine Veränderung zu benachbarten Frames darstellt[6] – Information ganz im Sinne Shannons. Einen beachtlichen Teil dieser Information stellen Daten dar, welche die Verschiebung von Pixel, respektive Pixelblöcken angeben. Da diese Veränderung gegenüber der Bildwerte anderer Frames als Bewegungsvektoren gespeichert werden, fallen die Key-Frames in der Regel auf die Schnitte im Video, also die Stellen, wo sich die Werte aller Pixel am meisten verändern. Um ein Beispiel zu machen: Eine einfarbige Fläche mit gleicher Helligkeitsstufe, die sich über das Bild bewegt, stellt für die Berechnung keine Veränderung dar und folglich keine Information, die gespeichert werden muss. Dieser Faktor bewegt monochrome Hintergründe in Datamosh-Videos zu besonders wirksamen Glitches.
Beim Prozess des Datamoshing werden die i-Frames entfernt, in denen die komplette Standbild-Information enthalten ist. Infolgedessen referieren die Bewegungsvektoren nicht mehr auf die ursprünglich vorhergehenden i-Frames, sondern auf den davorliegenden p- oder b-Frame, im Regelfall auf das Frame unmittelbar vor dem Schnitt. Die Bewegung der Pixel wird folglich nicht anhand des intendierten Ausgangsbildes (des i-frames) berechnet und das vorausgehende Frame blutet in das darauffolgende hinein, wodurch der visuelle Mosaik-Effekt entsteht.
Das Löschen von i-Frames zur Übertragung von Bewegungsvektoren auf vorausgehende Bildblockanordnungen wird bei Murata ergänzt durch einen zusätzlichen – mit 'Blooming' bezeichneten – Effekt, der auch unter Datamoshing subsumiert wird. Dieser resultiert aus der Repetition, dem Copy-Pasten von p-Frames, wodurch die Bewegung der Pixelblöcke im Bild wiederholt wird und sich diese entlang der Bewegungsvektoren mit jedem Frame duplizieren und zu Schlieren verziehen.

Ein Datamosh-Effekt, bei dem i-Frames entfernt wurden. Quelle: Datamoshing 101: How to Make Your Footage Look Trippy.

Ein Blooming-Effekt, bei dem p-Frames dupliziert wurden. Quelle: Datamoshing 101: How to Make Your Footage Look Trippy.
Muratas Monster Movie (2005) ist in verschiedener Hinsicht ein Testament an die Entkopplung von Bedeutung und Information. Erstere setzt Letztere voraus, aber die Information in der Codierung und Ausführung von Code funktioniert unabhängig von der intendierten Bedeutung, mit der sehr wohl auch eine Vorstellung von Funktionalität zusammenhängt. "[The machine] does not care whether an image is representational or made abstract through a form of data manipulation."[7] Aus dem Bildmaterial des B-Movies Caveman von 1981 wird eine abstrakte Masse von Farbe und Bewegung, die nur kurze Einblick in das sie konstituierende Monster erlaubt. Auf der anderen Seite beweist das Glitch Werk, dass es auch in der Glitch Art nur schwer ohne Sinnzuschreibung geht und wenn es noch um die Zerstörung des Sinns selbst geht. In einer Textstelle, die den politischen und sozialen Charakter einer Glitch Art mehr als anklingen lässt, schreibt Frieling über Monster Movie (2005): "Informed by a legacy of Hollywood thrillers and horror movies, his videos take on the job of destroying any illusion of identity and sustainability in the digital realm. Anything can be made out of ones and zeros. And anything can also be unmade just as easily."[8]
Neben seiner Rolle als frühes Datamosh Beispiel zu einer Zeit, in der YouTube erst gerade online ging, ist Monster Movie (2005) zugleich ein exemplarisches Zeichen für die ästhetische Institutionalisierung von Glitch Art und Datamoshing im Spezifischen. Muratas Werk wird 2010 in eine Ausstellung eines der renommiertesten Museen für moderne Kunst aufgenommen.[9] Ein Jahr zuvor stolziert Kanye West in seinem Musikvideo zu Welcome to Heartbreak (2009) durch ein Feld von Glitches,[10] die denselben Prozess anwenden, und besingt mit Kid Cudi die zum Video in metaphorischer Beziehung nahestehenden Imperfektionen seines Liebeslebens. Es ist kein Zufall, dass gerade Monster Movie (2005) einen solchen Erfolg feierte, ist es doch die Verbindung von Horrorfilm, Nostalgie und Glitch-Effekt, die darin miteinander einhergehen und zur Begleitung von rhythmischen Perkussionsklängen symbiotisch miteinander verschmelzen. Die bedeutenden Tropen von Horror im 20. Jahrhundert konstatiert Shaviro als Störung und Zusammenbruch des Raums ("disruption of space") und als Verzerrung der Zeit ("warping […] of time"[11]). Beide könnten als generelle Medieneffekte analysiert werden und beide fallen in der Methodik von Datamosh zusammen und supplementieren den Titel, welcher nicht nur auf die Kreatur im Originalfilm verweist, sondern auf ihren eigenen hybriden Charakter eines analog-digitalen Filmmonsters. In Bezug auf das Datamoshing wird die Dialektik zwischen diskreten Elementen und zusammenhängender Struktur, die spätestens seit dem Film eine viel behandelte Thematik ist, auf neue Weise relevant. Die einzelnen Frames in den Videos beinhalten Informationen, die nicht nur das eigene Bild ausmachen. Über eine symbolische und optische Interdependenz hinaus sind sie mit den vorhergehenden und folgenden Bildern verbunden, respektive hängen sie von ihnen ab. Dabei wird der räumliche Aufbau der Bilder sowie die kinematographische Zeitstruktur als Dialektik von Bewegung und Stillstand reorganisiert. Was eine kohärente Bewegung hervorbringt, ist nicht mehr (nur) die Abfolge von x Bildern pro Sekunde, die eine menschliche Wahrnehmungsschwelle übersteigt, sondern deren struktureller Zusammenhang, welcher das Abgebildete mitformiert.
So erinnern die Aufnahmen, die Murata modifiziert, zuletzt an eine andere Zeit von Kino und eine alternative Art Dinge zu tun. Das offensichtlich kostümierte Monster evoziert die B-Movie-Ästhetik der 1970er und 80er Jahre, deren retrospektiver Charme in vielerlei Hinsichten eine historisierende Verknappung und Romantisierung darstellt. Für die Argumente zur Hybridität steht dementsprechend auch dieses Werk ein, indem es zwischen alten und neuen Medien operiert und die vermeintlich überholten durch die gegenwärtigen appropriiert und beinahe bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Anstatt nach Medienspezifik Ausschau zu halten, beleuchtet es dabei die Prozesse der Codierung.[12] Und für diejenigen, die, wie Frieling schreibt, im auf dem Frame und der Narration gebauten Reich der Kinematographie gefangen sind, offeriert Monster Movie zumindest einen Trost in der Möglichkeit einer Medienarchäologie. "The narratives of cinema live on, but not in the way that we imagined it. For moments, there is then a sublime recognition of what once was."[13] Der Wandel, der durch das Präfix Post- markiert wird, stellt keine absolute Ablösung dar, sondern eine fortlaufende, ungleichmässige und ungewisse Veränderung.[14] Die Gegenwart ist voller Geister.
[1] Auf diese Ansicht, dass jedes Dateiformat seine medienspezifischen Glitches erzeugt, die auf es zurückverweisen, geht Rosa Menkmans Vernacular of File Formats ein. Vgl. Menkman, 2010. [2] TikTok – connection_intercepted. https://www.tiktok.com/@connection_intercepted (Stand: 17.02.2023). [3] Davis, Paul B. Define Your Terms (or Kanye West Fucked Up My Show). 2009. https://www.seventeengallery.com/exhibitions/paul-b-davis-define-your-terms-or-kanye-west-fucked-up-my-show/ (Stand: 17.02.2023). [4] Für eine ausführliche Abhandlung der technischen Prozesse vgl. Ito et al.: 2014. [5] Vgl. Menkman, 2010: S. 21. [6] Vgl. Zinman, 2015: S. 107. [7] Temkin, Daniel. Glitch & & Human/Computer Interaction. The Journal of Objectless Art (2014). https://nooart.org/post/73353953758/temkin-glitchhumancomputerinteraction (Stand: 17.02.2023). [8] Frieling, Rudolf. Takeshi Murata. "Monster Movie" (2005). 2009. https://archiv2019.kunstverein-bielefeld.de/en/exhibitions/subjective-projections/takeshi-murata.html (Stand: 17.02.2023). [9] Vgl. Menkman, 2011b: S. 55. [10] Vgl. Davis, Paul B. Define Your Terms (or Kanye West Fucked Up My Show). 2009. https://www.seventeengallery.com/exhibitions/paul-b-davis-define-your-terms-or-kanye-west-fucked-up-my-show/ (Stand: 17.02.2023). [11] Shaviro, Steven. What is the post-cinematic? 2011. http://www.shaviro.com/Blog/?p=992 (Stand: 17.02.2023). [12] Vgl. Zinman, 2015: S. 99. [13] Frieling, Rudolf. Takeshi Murata. "Monster Movie" (2005). 2009. https://archiv2019.kunstverein-bielefeld.de/en/exhibitions/subjective-projections/takeshi-murata.html (Stand: 17.02.2023). [14] Vgl. Denson & Leyda, 2016: S. 2.