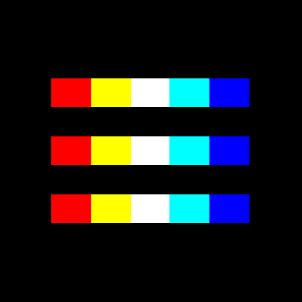3.3. Weitere Begriffe
- Marinus Börlin
- 14. Feb. 2023
- 11 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023

Error
"An error might produce a glitch but might not lead to a perceivable malfunction of a system."[1]
Der Begriff Error, wie ich ihn hier untersuche, markiert eine Abweichung von einem vorbestimmten Ausgang.[2] Er folgt jedoch im Gegensatz zum Glitch einem systemähnlichen Ziel, respektive ist er in der Logik von Feedback und Kontrolle sogar für das Erreichen eines Ziels massgeblich. Der Error nimmt in diesem Kontext, der massgeblich durch Wieners Überlegungen zur Kybernetik geprägt ist, die Rolle einer Korrektur ein, anhand welcher die Steuerung angepasst wird. Er ist so weit tolerierbar, als dass er nicht das Ausmass übersteigt, in dem seine Abweichungen nicht mehr systematisch innerhalb der Protokolle der Kontrolle vereinnahmt werden können.[3]
In Bezug auf die Rahmenbedingungen von zielgerichtetem Verhalten (von Menschen oder Code) in nicht deterministischen Systemen innerhalb der dominanten Ideologie einer Netzwerkgesellschaft gibt es demnach systeminterne Fehler in zwei verschiedenen Formen: Auf der einen Seite der bereits angesprochene Error, welcher eingefangen ist, vorhergesehene Abweichung darstellt und der herrschenden Ordnung (sozialer oder technischer) durch Feedback und systematische Kontrolle dient. Auf der anderen Seite Fehler die mäandern und sich der Vorhersage, den Programmen und den Protokollen entziehen.[4] Die Bewertung dieser zwei unterschiedlichen Fehler offenbart demzufolge die Bewertung des Systems als (vermeintlich) Ganzes. Die ersteren folgen einer Logik der Kybernetik. Sie sind in Systemen verortet, die gleichzeitig universal und abgeschlossen sind. Die letzteren fallen unter die Logik von Glitch. Ohne dass sie von einem Ausserhalb kommen, öffnen sie die Systeme und machen diese gleichzeitig partikular, indem sie zeigen, dass die Grenzen konstruiert sind und darin kontingent; dass die Kontrolle in der Praxis Lücken aufweist, auch wenn das digitale System eine absolute Berechenbarkeit suggeriert. Mit Virilio argumentiert ist der Fehler ab dem Zeitpunkt der Produktion bereits in ein Produkt einprogrammiert, paradoxerweise auch oder vor allem dann, wenn es sich um nicht vorhergesehene handelt. Seine Aufzählung lässt sich ohne Weiteres um den Glitch ergänzen: "Oceangoing vessels invented the shipwreck, trains the rail catastrophe, fire the forest fire"[5] und elektronische Signalübertragung und Datenverarbeitung den Glitch.
Der Error als inkludierter Fehler steht damit für die Unvereinbarkeit der Positionen, die Fehler an jeder Stelle auszuschliessen versuchen und gleichzeitig Fehler als notwendiges, korrektives Mittel in teleologischen Systemen einsetzen. Im Kontext der Kontrollgesellschaft und der spätkapitalistischen Logik, geht die konstatierte Alternativlosigkeit so weit, dass sogar der Fehler assimiliert wird und zur Steigerung der Produktivität führen muss. Der Glitch eröffnet dementgegen realistische Alternativen.
Noise
Der Begriff Noise hat in seiner Verwendung und in der Übersetzung – nicht nur ins Deutsche[6] – eine gleichzeitig prekäre und produktive Mehrdeutigkeit. Er wird als (Stör-)Geräusch übersetzt, als Lärm und auch als Rauschen. Also auf der einen Seite als kurze Störung, als Unterbruch, als Ausseneinwirkung. Auf der anderen Seite als kontinuierliche Präsenz, als Fluss, als Umgebungsrauschen. Diese Umschreibungen tragen einen deutlich auditiven Kontext mit sich: ein lautes Geräusch, Stadtlärm, das Rauschen des Meers. Für die hier notwendige Klärung ist jedoch eine Übertragung dieser Termini aus der Verwendung im Auditiven heraus notwendig. Anekdotisch ist der Anfang dieser Übertragung bei Winthrop-Young beschreiben:
"That sound [the sound of the sea], incidentally, is referred to in German as Rauschen. A cognate of English 'rustle,' it also describes the swaying of trees and the rustling of hedges in the wind, and it is easily one of the most overused words in German poetry since the age of Goethe, primarily because of the way its onomatopoeic beauty conjures up natural sounds full of poetic significance. But in one of the most remarkable semantic extensions ever undertaken in any language, German physicists in the 1920s came to use Rauschen to denote a disturbance variable with a broad-frequency spectrum - what in English is called (white) noise."[7]
So schön und geeignet diese Anekdote für das Rauschen und die "poetics of noise"[8] einspringt, ist sie doch nur einem Aspekt von Noise treu. Breiter noch gedacht und gelesen, handelt es sich in dieser Übersetzung um eine Übertragung des Noise, hier als Rauschen, aus der Klangwelt in diejenige der Kommunikationstechnologien und spezifisch die Befassung der Informationstheorie mit Übertragungskanälen. Dort erhält das Noise durch die Theoretisierung von Shannon eine neue Rolle. Jacques Attali schreibt in Noise – The Political Economy of Music diesbezüglich:
"Information theory uses the concept of noise […] in a more general way: noise is the term for a signal that interferes with the reception of a message by a receiver, even if the interfering signal itself has a meaning for that receiver."[9]
In dieser für die Komplexität des Themas vergleichsweise luziden Definition stecken einige Punkte. Allem voran steht dabei das Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver, in dem ein Sender ein Signal über einen Transmitter durch einen Kanal sendet, worauf dieses über einen Empfänger an seinem Zeil ankommt.

Das Noise in diesem Schema hat dabei wie die sprachliche Übersetzung zwei verschiedene Aspekte, es besetzt zwei Orte. Erstens ist das ein Aussen. Eine externe Interferenz, markiert durch den Pfeil im Schema, dringt in die Übermittlung als unerklärte Variation und zufälliger Fehler ein und fügt dabei gleichzeitig mehr Informationen hinzu. Weaver führt aus: "In the process of being transmitted, it is unfortunately characteristic that certain things are added to the signal which were not intended by the information source. These unwanted additions may be distortions of sound (in telephony, for example) or static (in radio), or distortions in shape or shading of picture (television), or errors in transmission (telegraphy or facsimile), etc. All of these changes in the transmitted signal are called noise."[10] Im linearen Modell von Sender-Kanal-Empfänger in der Informationstheorie ist demnach alles, was von ausserhalb dazu kommt und das Signal verändert, Noise.[11]
Zweitens ist es der Kanal und damit verbunden das Signal selbst, welcher von Noise besetzt wird. Im Gegensatz zum Noise von aussen, ist dieses keines das dazu kommt. Es handelt sich nicht um externe Faktoren, sondern um die konstitutive Art und Weise, wie der Kanal die Botschaft codiert vermittelt und sie dadurch überhaupt erst informativ macht. Information – bei Shannon explizit nicht mit Bedeutung zu verwechseln – zeichnet sich durch ihr Verhältnis zu diesem Noise aus: Dort, wo ein Signal von der Gleichverteilung abweicht, steht es für Information. Je grösser die Unwahrscheinlichkeit des Signals, desto mehr Information enthält es.[12] Diese zwei Orte und die doppelte Rolle von Noise subsumiert Ballard im konstitutiven Zusammenhang zur Information: "Noise is both the material from which information is constructed, as well as being the matter which information resists."[13]
Ein weiterer Aspekt dieser konstitutiven Seite von Noise im Kanal ist, dass Noise selbst Teil der Botschaft werden kann und somit zum Träger von Information. Wie Kittler mit Shannon argumentiert, ist Kommunikation immer Kommunikation in der Gegenwart von Noise und dies aus zweifachem Grund: "nicht nur weil reale Kanäle nie nicht rauschen, sondern [auch] weil Nachrichten selber als Selektionen oder Filterungen eines Rauschens generierbar sind."[14] So gesehen ist Noise, wenn als Quantität gemessen, produktiv und fügt im Gegensatz zu Erwartbarkeit und Wiederholung Information hinzu.[15] Gleichzeitig kann dadurch eine Botschaft durch Kodierung in der Störung versteckt, wie auch eine Störung als Botschaft interpretiert werden. Infolge werden die Positionen im Kommunikationsschema uneindeutig. Es ist diese multiple und verschwommene Rolle von Noise und Information, welche Serres zu seiner folgenreichen Schlussfolgerung gebracht hat: "Kein Kanal ohne Rauschen."[16] Das Noise ist demzufolge immer schon da und dies ausserhalb der Kanäle und auf sie einwirkend, sowie innerhalb der Kanäle und sie konstituierend. Noise ist anderen Worten ein konstitutiver Aspekt von mediatisierten Umgebungen; "often ignored but always present."[17]
Durch die Informationstheorie von Shannon, auf die sich auch Menkman in ihrer Glitch Forschung bezieht,[18] nimmt die Störung eine neue Rolle ein, welche sie in ein Verhältnis zum Noise, dem Rauschen des Kanals setzt und gleichzeitig davon abgrenzt. Wo der Error als erwarteter und einberechneter Fehler dazu verhilft, das System auf ein intendiertes Ziel hinsteuern, steht das Noise für die Öffnung des Raums zwischen dem Tatsächlichen und dem Möglichen.[19]
"Control provides a system for guiding communication from intention to intention. In contrast, the error of noise marks a potential to throw off systems of control by deferring the actual (message received) and sustaining the virtuality of equivocation."[20]
Genau darin liegt die ideologische Komponente von Glitch Art verborgen. Es geht dabei nicht darum, im Krieg zweier Nationen den Nachrichtenfluss zu hindern, sondern darum die codierte Information, die ein Status Quo im hegemonialen System immer schon in vorprogrammierter Weise an Rezipient:innen sendet, zu stören, um aufzuzeigen was wirklich kommuniziert wird. Glitch und Noise Art gehen in dieser Hinsicht durch die Informationstheorie – und wie diese – wieder zurück zur Logik des Auditiven, wo sich innerhalb derselben Soundumgebung stets die Frage stellt, was ist Klang und was Lärm, was Haupt- und was Nebensache, was Signal und was Rauschen. Und wo durch strategische Interventionen diese Zuordnungen reorganisiert werden können. Unter dieser Perspektive ist es schliesslich auch nicht relevant, ob die Glitches mit tatsächlichen Unfällen aus dem analogen Rauschen der Welt oder fehlerhaft programmiertem Code heraus entstehen, oder ob sie absichtlich eingeführte störende Informationen wiedergeben. "Dem Computer ist es schliesslich egal, ob er listige Verschlüsselungen oder natürliches Rauschen zu verarbeiten hat."[21] Abraham Moles fasst diese strukturelle Indifferenz zusammen: "There is no absolute structural difference between noise and signal […] the only difference which can be logically established between them is based exclusively on the concept of intent on the part of the transmitter: a noise is a signal that the sender does not want to transmit."[22] Noise kann eben auch ein Signal sein, dass den Eindruck vermittelt, nicht die Hauptsache zu sein, sondern nur nebensächliches Rauschen.
Bug
Bug und Glitch werden als Begriffe häufig austauschbar verwendet.[23] Sie beide verweisen wie der Error auf Fehler in dem Sinne, dass sie gegen Absichten und Vorstellungen von als korrekt empfundener Funktionsweise verlaufen. Im Vergleich wird der Bug häufig als schwerwiegenderes Phänomen mit grösserer Tragweite verstanden. Der Glitch hingegen geht mit einer mysteriösen Seite einher, die von Unwissen und Überraschung gekennzeichnet ist.[24] Bezogen auf den Glitch schreibt Pieschel, dass er durch unerwartete Inputs hervorgerufen wird oder durch "stuff outside the realm of code."[25] Gerade dieser letzte Punkt ist als Argument für die Distinktion interessant, wo doch eine mögliche etymologische Herleitung des Wortes Bug Insekten einsetzt, die sich in Schaltkreisen verirrt und dadurch Programmfehler erzeugt haben.[26] Begriffsgeschichtlich argumentiert, liesse sich folglich die Unterscheidung machen, dass ein Glitch eine kurzweilige Veränderung darstellt, die Konsequenzen unterschiedlichen Ausmasses haben kann, während ein Bug eine Störung in programmierten Umgebungen darstellt, die Fehler generiert, bis sie behoben wird. Dieser Ansatz liefert zwar Beschreibungen zweier unterschiedlicher Phänomene, erklärt jedoch nicht die Verbindung der beiden oder den gegenwärtigen Kontext, in dem beide oft für technisch gesehen sehr ähnliche Störungen verwendet werden.
Eine Präzisierung der Begriffe ergibt sich durch die Inklusion eines weiteren, namentlich dem "Debugging". Die Verwendung und Verbreitung dieses Ausdrucks gegenüber dem sehr viel selteneren "Deglitch" tragen relevante Implikationen in sich und greifen mindestens teilweise die begriffsgeschichtlichen Argumente auf. Ein Bug ist etwas, das zuverlässig gesucht, gefunden, diagnostiziert und korrigiert werden kann.[27] Ein Glitch hingegen entzieht sich durch seine Temporalität und Unfixiertheit dieser einfachen Struktur von Fehler und Korrektur.
"Though it retains many of the negative connotations of 'bug', glitch also has come to imply something more transient, abnormal, illogical, impermanent, or unreliable, experienced in its immediacy and then lost, like divine visitation or natural disaster. Bug implies some mundane mistake that we can blame on the person who wrote the code, while the perp is harder to pinpoint when it comes to glitches – could be hardware, could be users, could be ghosts."[28]
Im Kontext von Computerspielen liefert Holmes eine verallgemeinerbare These zur Unterscheidung von Bug und Glitch, welche auf dieser Argumentation unter dem Einbezug von Debugging aufbauen lässt. Sein Vorschlag setzt nicht bei der Art der Störung an, sondern bei der Rolle der Person, welche diese erfährt. Er schreibt, dass Glitches beinahe immer den Effekt von Softwarefehlern für die User:innen bezeichnet, Fehler, die entdeckt werden, bevor ein Computerspiel veröffentlicht wird, hingegen durch die Entwickler:innen den Stempel eines Bugs erhalten.[29] Während sie also grundsätzlich gleiche technologische Phänomene beschreiben können, unterscheiden sie sich insofern, wie mit ihnen umgegangen wird. Bugs werden von Programmierer:innen ausfindig gemacht und korrigiert, Glitches von Spieler:innen entdeckt und ausgenutzt.[30] [Vgl. 4.3.3. Glitches in Games] Bugs sind mit proprietärer Autor:innenschaft verbunden, Glitches mit spielerischer und experimenteller Appropriation. Use, misuse und abuse sind allesamt Formen von Nutzung. Es ist diese Unterscheidung, die erklärt, wieso Glitches, welche aus den diversesten Fehlern entspringen können, gegenüber den Bugs in der Konsumkultur an Popularität gewinnen. Gerade im Kontext der Computerspiele sorgen Unmengen an Playtests, nebst hochfrequentierten Patches für einen Rückgang in Bugs und umgekehrt zelebrieren User:innen die ermächtigende Entdeckung von und das experimentelle Spiel mit Glitches mehr und mehr.
"[In] a sea of perfectly orchestrated, intensely focus-tested games it's refreshing to see something slip through the cracks and give me a taste of what wasn't meant to be. It's like a small act of defiance."[31]
Im digitalen Umfeld sind Debuggers damit beauftragt, die fehlerhaften Dateien, Hard- und Softwares zu kontrollieren und deren Ursachen, sowie Folgen zu beheben oder zu reduzieren. Glitch Artists auf der anderen Seite nehmen dazu die Gegenposition ein. Als "Re-Buggers"[32] provozieren und verstärken sie Glitch Artefakte absichtlich. Sie generieren oder modifizieren Software und Hardware mit der Absicht, mehr solcher Artefakte hervorzurufen, die für fehlerhaftes Verhalten stehen.[33]
Artefakt
Mit der Bezeichnung des Artefakts wird zwischen medialen Oberflächen-Effekten und den dafür verantwortlichen Prozessen eine begriffliche Trennung eingeführt. "The glitch is the entropic process acting on the data, whereas the artifact is what is produced when that altered data is read." sagt beispielsweise Phillip Stearns.[34] In dieser Hinsicht hängt der Ausdruck eng mit den Debatten um die Sichtbarkeit des Digitalen zusammen und suggeriert eine indexikalische Verbindung zwischen Artefakt und Übersetzung, Noise, Glitch, usw., welche diesem sprachlich vorgestellt werden. So gibt es Kombinationen wie Pixel Artefakte, Compression Artifacts, Noise Artifacts, und wie bereits erwähnt Glitch Artefakte. Das gemeinsame der damit beschriebenen Entitäten, das was der Begriff des Artefakts bezeichnet, ist dabei ein durch die menschlichen Sinne wahrnehmbares Element, das aus einem nicht in gleicher Weise wahrnehmbaren, technischen Prozesses resultiert. Stern beschreibt die Übernahme wie folgt:
"I am borrowing the term artifact from computer science where the term is used in reference to undesired cosmetic disturbances such as jagged edges or dirty patches in an image file (common in compressed digital video or jpeg images for example), excess noise or hiss in a sound stream, or unpredictable ASCII characters in a text file. Artifacts differ from bugs, which are usually caused by programming mistakes; artifacts don't prevent functionality per se, but cause an unperfected aesthetic disturbance."[35]
In dieser Beschreibung lässt sich sowohl die Verbindung wie auch die Unterscheidung zum Glitch erkennen, welche über die Vermengung von Glitch und Glitch Artefakt als synonym hinaus geht. Allem voran stecken diese in der kurzen Formel "artifacts don't prevent functionality per se", welche in der Funktionalität eine absolute, wenn auch theoretische zuschreibbare Eigenschaft sieht, die im Kern vieler der Widersprüchlichkeiten um Glitch Art steht und mit dem unscheinbaren "per se" die ganze Box von digitaler Kontrollillusion[36] öffnet. Vorerst ist die Beziehung aber noch konkreter beschreibbar.
Im Gegensatz zum Glitch, der als Störung mit einem Unfall oder einer absichtlich herbeigeführten Fehlfunktion zusammenhängt, können Artefakte, die als Glitches empfunden und beschrieben werden, sehr wohl, wie Stern schreibt, die Folge eines regulär funktionierenden Systems sein. Diese, von Goriunova & Shulgin ebenso als Glitch Artefakte bezeichneten, stammen beispielsweise von diversen technischen Limitationen ab, wie einer tiefen Geschwindigkeit der Bildprozessierung oder einer geringen Bandbreite beim Abspielen von Videos.[37] Ein Beispiel für ein solches, dass ebenso aus einer regulären Funktion einer Datenkompression entstehen kann, ist das "Posterization Artifact".[38] Bei diesem wird durch die Reduktion der Farbtiefe an Stellen von Verläufen im Bild ein Übergang zwischen den diskreten Regionen erkennbar. Unter Berücksichtigung der Verbreitung dieser Kompressionsverfahren und der Frequenz, mit der solche Videos und Bilder konsumiert werden, dürften diese Artefakte den meisten Leuten schon einmal begegnet sein.


Es ist jedoch ebenso möglich zu sagen, dass visuelle Glitches, wie Moradi schreibt, als Artefakte die visuelle Manifestation von Fehlern sind. Sie stellen dabei weder die Ursache noch den Fehler selbst dar, sondern schlicht deren Produkt.[39] Im Folgenden gilt es weiter zu untersuchen, wie diese Aussagen nebeneinander bestehen können, ohne dass die eine als richtig und die andere als falsch gekennzeichnet wird. Es beginnt damit, dass über die verschiedenen Formen von Artefakten ansatzweise ersichtlich wird, wie Glitch Art nicht nur wahrnehmbare Resultate von Glitches, sondern einer Vielzahl an technischen Prozessen in Kommunikationsmedien umfasst, von denen auch nur ein Bestandteil direkt mit dem Computer zusammenhängen. Unter diesen Gesichtspunkten wird es auch nachvollziehbar, wenn Rosa Menkman in ihrem Glitch Studies Manifesto von der "art of artifacts"[40] spricht.
[1] Goriunova & Shulgin, 2008: S. 211. [2] Vgl. Nunes, 2011: S. 7. [3] Vgl. ebd.: S. 7. [4] Vgl. ebd.: S: 12. [5] Virilio, 1993: S. 212. [6] Vgl. Serres, 1987. [7] Withrop-Young, 2011: S. 81. [8] Nunes, 2011: S. 14. [9] Attali, 2009: S. 27. [10] Weaver, 1949: S. 4. [11] Vgl. Ballard, 2007. [12] Vgl. Pias, 2003. [13] Ballard, 2007. [14] Kittler, 1993: S. 168. [15] Vgl. Ballard, 2007. [16] Serres, 1987: S. 120. [17] Kane, 2019: S. 14. [18] Vgl. Menkman, 2011: S. 12. [19] Vgl. Nunes, 2011: S. 13. [20] Ebd.: S. 13. [21] Winthrop-Young, 2018: S. 141. [22] Moles, 1969: S. 78. [23] Vgl. Goriunova & Shulgin, 2008: S. 211. [24] Vgl. Pieschel, 2014. [25] Ebd. [26] Vgl. Plant, 1998: S. 127 ff. [27] Vgl. Pieschel, 2014. [28] Ebd. [29] Holmes, 2010: S. 275, Fussnote 15. [30] Vgl. Pieschel, 2014. [31] Hernandez, Patricia. It's Not A Glitch. It's A Feature. It's Art. It's Beautiful. 2012. https://kotaku.com/its-not-a-glitch-its-a-feature-its-art-its-beautiful-5933722 (Stand: 17.02.2023). [32] Menkman, 2011b: S. 46. [33] Vgl. ebd.: S. 46. [34] Stearns, Phillip zit. nach: Chayka, Kyle. Faultline: An Interview Exploring Glitch Art. (Hyperallergic). 2012. https://hyperallergic.com/56704/faultline-an-interview-exploring-glitch-art/ (Stand: 17.02.2023). [35] Stern, 2002: "A note on 'Artifacts'". [36] Vgl. Pias, 2003: No. 55. [37] Vgl. Goriunova & Shulgin, 2008: S. 111. [38] Vgl. Menkman, 2010: S. 19. [39] Vgl. Moradi, 2009: S. 8. [40] Menkman, 2011a: S. 346.