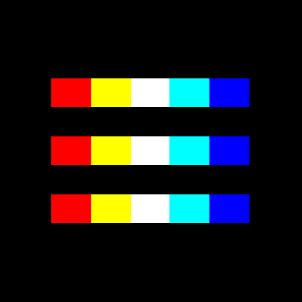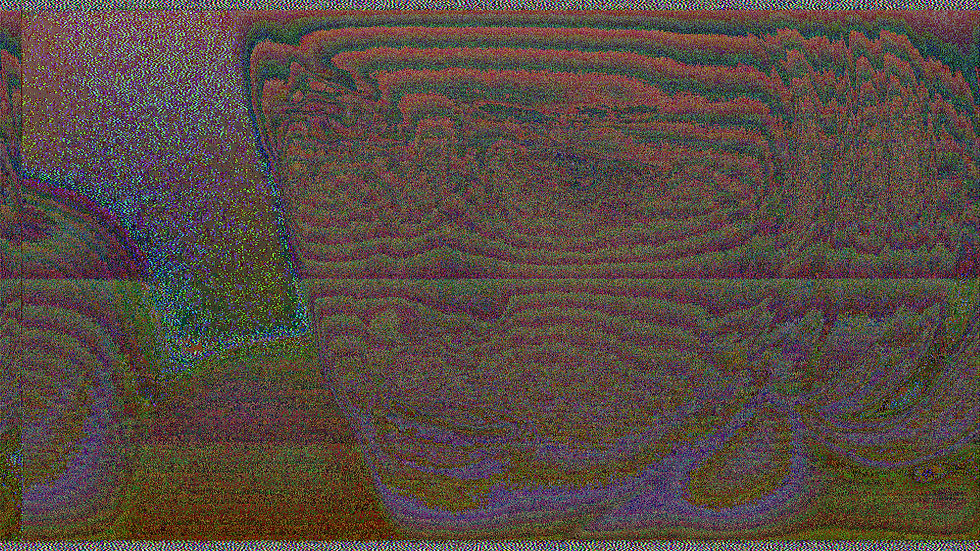4.2.3. Found Footage Horrorfilme
- Marinus Börlin
- 7. Feb. 2023
- 9 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023
V/H/S - Official International Trailer. Epic Pictures Group. 2012. [Triggerwarning: Gewalt]
Shaviro nennt im Zuge des Dilemmas von Kontinuität und Bruch mit neuen digitalen Filmtechnologien die ersten Paranormal Activity Filme. Diese nutzen die neuen Technologien spezifisch für das Filmschaffen und inkorporieren sie in der Produktion gleichzeitig in ihre Narrative. Dadurch greifen sie eine allgemeinere selbst-reflexive Tradition und Konvention von Filmschaffen auf und funktionieren bestehende modi operandi um. Zugleich beschäftigen sie sich aktiv mit den neuen formellen Möglichkeiten, welche durch die veränderte Technologie bewerkstelligt werden.[1] In diesem Ansatz gehen sie über die sich ab dem frühen 20. Jahrhundert verbreitende, modernistische Forderung hinaus, dem Film selbst getreu zu werden und beweisen zugleich, dass sich diese Momente der experimentellen Neuverhandlung des Films nicht nur im Bereich des Experimental- oder Art-House Films abspielen.[2] Diese Argumente von Medienspezifik stehen dabei stets senkrecht zu einer Theorie der Remediation,[3] in der konstatiert wird, dass Medien am besten daran erkennt werden, wie sie ihnen vorausgehende aufgreifen, kontrastieren und ummünzen. Entgegen diesem Ansatz versuchten zahlreiche Filmschaffende und Filmtheoretiker:innen, den Film vom Theater, von der Fotographie und von anderen Einflüssen zu befreien, um Film im Film darzustellen und Film an sich zu fassen. Diese Diskurse sind dabei beispielsweise auch auf die Malerei übertragbar, beziehungsweise stammen wohl zu grossen Teilen aus deren Kontexten. Eine entsprechende Perspektive geht von abstrakter Malerei als Kunst aus, die sich den medienspezifischen Qualitäten der Malerei widmet und dabei selbst-reflexiv mit diesen umgeht. Durch die Absenz von figurativen und narrativen Elementen kann sie auf ihre basalsten Elemente reduziert werden: Die Leinwand, die Farbpigmente, Farben und Formen.[4] Eine Adaption dieses Zugangs auf die Glitch Art lässt sich etwa in Daniel Tempkins Glitchometry-Reihe finden, in der einfache geometrische Strukturen als Grundlage der Experimente mit statischen visuellen Glitch-Effekten verwendet werden.[5] Zu diesem Versuch einer auf die Spitze getriebenen Selbst-Referenzialität in der materialistischen Tradition kommen im Kinofilm bewusst eingesetzte mediale Störungsmomente hinzu, welche die selbstverlierende oder unbeteiligt voyeuristische Filmrezeption der klassischen Kinosituation aufbrechen und Momente der Hypermediacy[6] einführen. Diese können ihrerseits Teil einer Suche nach dem Spezifischen des Mediums sein, weshalb sie lange hauptsächlich im Experimentalfilm eingesetzt wurden, oder aber sie resultierten aus dessen künstlerischer Forschung und fanden in Folge Verwendung in konventionelleren Werken.
Im Genre des Horrorfilms – ein Genre das generell bereits von Selbstreferentialität und -reflexivität gekennzeichnet, sowie von technologischem Spuk heimgesucht ist – fand diesen Bewegungen folgend die Glitch Art als experimentelle und materialistische Strategie einen Nährboden. Insofern breitete sich diese im Kino oder zuhause auf dem Fernseher aus und verwischte die Grenze zwischen experimenteller, technischer Medienkunst und populär-kulturellen Erzeugnissen. Wieso dies gerade im Horrorfilm geschah, hat mehrere Gründe. Erstens ist das Horror-Genre mit einer Affinität und Sensibilität für die jeweils gängigen, gegenwärtigen technologischen Kommunikationskanäle gesegnet:
"Gothic [horror] is always one of the first genres to make use of new and emerging media forms because its traditional concerns with disruption and monstrosity match up so well with the anxieties that new forms of media inevitably provoke in the societies within which they appear."[7]
Zweitens hat die Rolle von Glitch im Kontext des Horrors einen spekulativen Bezug zur Rolle von Glitch im Kontext der Glitch Art, die jedoch über eine schlichte Adaption des Glitches für künstlerische Zwecke hinausgeht. “[These] aesthetics", schreibt Rosa Menkman über Glitch Art, "show a medium in a critical state: a ruined, unwanted, unrecognized, accidental and horrendous moment.”[8]Wenn im Horrorfilm plötzlich die Kamera wahrnehmbar wird, weil ein Glitch ihren Informationsfluss stört, werden wir uns der unheimliche Situation bewusst, dass wir nicht durch, sondern auf etwas schauen und wir hinterfragen plötzlich, wer und was für unsere Wahrnehmung verantwortlich ist, wenn es nicht wir selber sind.
Der erste Punkt hängt damit zusammen, dass die Bildstörungen als Disruption der Medien auf den Zusammenbruch des Raums und die Verzerrung der Zeit hinweisen. Wo zuvor die gespenstischen Antagonist:innen in Wohnräume eingedrungen sind, besetzen sie nun zusätzlich die medialen Räume der Kommunikation und Informationsflüsse, welche die Neukonstitution des Raumes auf viel allgemeinerer Ebene verantworten. Dass die Horrorfilme im 20. Jahrhundert den Zerfall von Raum und Zeit thematisieren,[9] hängt dabei untrennbar mit ihrer Liaison zu Medien zusammen. Die Medien übernehmen die gespenstische Funktion, Raum- und Zeitkonstellationen von jeglicher Zuverlässigkeit zu entkoppeln. Dadurch ist es nur logisch, dass diese mit den monströsen Entitäten zusammenfallen, die zuvor die Ordnungen des Raumes und der Zeit missachteten. Wo die neuen Medien auf der einen Seite eine produktive Reorganisation im Zerfall darstellen könnten, zeigen sie gleichzeitig, wie unnachgiebig die Vergangenheit ist und wie unvereinbar die Systeme nicht nur auf technischer Ebene sind – da lassen sie sich allenfalls sogar noch übersetzen oder zumindest transcodieren – sondern auch auf der Ebene ihrer vorgestellten Funktionsweise und sozialen Logik. Was die zerfallende Architektur einer vergangenen Ära von heimgesuchten Wohnsitzen für die Literatur im 19. Jahrhundert war, repräsentieren die Daten-Ruinen für ihr Pendant im 21.: «the privileged space for confrontations with incompatible systems, nostalgic remnants, and restless revenants.»[10] Aus dem Spuk im antiken Gebäude wird der Spuk im Datenraum; Risse im Gemäuer werden zu verpixelten Schlieren im Bild.
Es ist diese Stelle, die eine Glitch Ästhetik im Film besetzt. Ganz explizit wird dies im Subgenre der Found Footage Horrorfilme, zu denen auch die bereits angesprochene Paranormal Activity Reihe gehört. Viele dieser Filme, die in den frühen 2010er Jahre produziert wurden, vereinen nach Olivier eine «glitch aesthetic that exploits the shock of a digital noise event for the sake of gothic horror.»[11] Das Auftreten von übernatürlichen Kräften und Wesen deckt sich dabei mit dem Auftreten von Störungseffekten diverser involvierter Medien, welche ihrerseits zu wiedererkennbaren visuellen und stilistischen Tropen in filmischen Geistergeschichten werden. Der Horroraspekt im Film entsteht daraus, dass wir nicht wissen, wieso und wie es zum Glitch gekommen ist. Einerseits sind metaphysische Wesen im Spiel, die zwar auf die Technologie einwirken, aber nicht durch deren Logik erklärt werden können. Andererseits lässt der Film keine weitere Erkundigung zu, da alle seine Effekte lediglich an der Oberfläche stattfinden. Das kritische Moment von Glitch Art wird in den Filmen nie umgesetzt. Die medienreflexive Realisierung von konventionaler Funktionalität wird den Betrachtenden vorgeführt und im selben Augenblick vorenthalten. Was Menkman als erste Funktion von Glitch Artefakten in einer kritischen Medienästhetik anführt, trifft nur teilweise zu: "This transforms the way the consumer perceives its normal operation (every accident transforms the normal) and registers the passing of a tipping point after which it is possible for the medium to be critically revealed at greater depth."[12]
Das Nichtfunktionieren wird wahrgenommen und die Realisierung des Abnormalen findet statt. Es kommt jedoch nicht zum "tipping point". Die Frage danach, was nicht stimmt, wird reduziert auf die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Das Aufwachen vom Traum der transparenten Kommunikation stellt sich mit den Found Footage Horrorfilmen als blosse Realisation des Träumens heraus, in der kein Tag Erlösung von Monstern bringt. Die wenigsten Horrorfilme dienen ihren Zuschauer:innen mit einem Happy End. Aber sie enden, während die in ihnen verarbeiteten Kommunikations- und Medientechnologien die Betrachtenden weiter heimsuchen und wenn auch nur als Erinnerungen an eine Zeit, in der sie durch die Brille der Nachsicht etwas weniger immateriell und transparent wirken als die gegenwärtigen.
Die Intransparenz, beziehungsweise Wahrnehmbarkeit der Sichtbarmachung ist in diesem Fall, wenn auch nur temporär, gerade die Möglichkeitsbedingung für die Funktion der Technik Geister aufzuzeigen. Dass ein Glitch nur kurzweilig ist, erlaubt ihn von einer regulären Funktionsweise und kontinuierlichen Störeffekten zu unterscheiden und ermöglicht ihm, Anwesenheit und Abwesenheit zu variieren. Nach Nick Rombes sind es an diesem Punkt nicht mehr die Häuser oder die Charaktere, die heimgesucht werden, sondern die Kameras selbst.[13] Und mit den Geistern sind sowohl die Gespenster, als auch die unheimlichen Bedingungen gemeint, die unsere alltägliche Kommunikation steuern, während sie sich hinter schwarzen Schirmen und der Illusion einer perfekten störungsfreien Übertragung verstecken und dadurch verhindern, dass wir mit Sicherheit wissen können, welche Funktionsweisen gerade am Werk sind. In dieser Hinsicht ist die Störung stets auch ein Indiz für Authentizität und ihre Adaption oder Simulation ein Stilmittel zur Vermittlung einer getreueren Wahrheit.[14] Das Spiel mit "found document"- oder "found footage" Elementen, ist neben dem Experimentalfilm gerade im Horror Genre sehr beliebt und weit über den Film hinaus verbreitet. Es zeugt in diesem durch die unabgeschlossene und gegenüber einer bestimmten Konvention dysfunktionale Struktur eines Textes indirekt von dem Schicksal, das dessen Autor:innen befallen hat.[15] Es ist dasselbe Schicksal, welches die potentielle darauf folgende Bearbeitung der Dokumente, sowie die Behebung ihrer Fehlerhaftigkeit und Unfertigkeit verhindert hat. Diese Unabgeschlossenheit in verschiedener Hinsicht validiert zugleich das Werk, weil sie es von einem weiteren erkennbaren Motiv seitens der Autor:innen abkoppelt. Dar Fakt oder die Simulation, dass es "found footage" ist, trennt die Autor:innen und deren Vorhaben von den Absichten derjenigen, die sich die Aufnahmen aneignen, allfällig bearbeiten und weiterverbreiten. Wie weit diese beiden Intentionen auseinander liegen können, lässt Fleischs Wound Footage erahnen. Das Bewusstsein einer medial vermittelten Welt, die Medienliteralität im weitesten Sinne und der einhergehende Technoskeptizismus lösen das vermeintliche Paradoxon auf, in dem weniger transparente Kanäle mehr Authentizität vermitteln, insofern als dass diese ihre Bedingungen offenbaren. Und diese Erkenntnis wird wiederum umgemünzt und angeeignet um Authentizität in der Fehlerhaftigkeit zu simulieren. Wenn Menkman von einer "spectator literacy"[16] schreibt, auf die das Genre von Glitch Art ausgiebig angewiesen ist, dann ist diese den gleichen Transformationen und Appropriationen ausgesetzt, wie die Glitch Art selbst.
Diese Argumente fliessen in den zweiten Punkt ein, worin die Verbindung zwischen Glitch im Horrorfilm und Glitch in der Glitch Art aufgezeigt werden soll. Obwohl die Found Footage Horrorfilme immer wieder Medientechnologien thematisieren und aufzeigen wie auch deren Störungen als Affektmittel nutzen, sind sie Vorstellungen bezüglich der Glitch Art i.e.S. nicht sonderlich nahe. Erstens wird in ihnen weniger oder kaum zwischen einem kurzlebigen Glitch, einem Systemcrash und dem wahrnehmbaren Rauschen der Kanäle unterschieden. Zweitens sind die Effekte im Regelfall genau das: Effekte – also nachprogrammierte Designs. Wenn heimgesuchte Kameras in den Found Footage Horrorfilmen plötzlich auf ihre Materialität verweisen, dann sind das nicht gezwungenermassen die tatsächlichen Kameras und Kameratechnologien, welche für die Filmproduktion verwendet wurden, sondern simulierte und innerdiegetische Kameras, welche durch spezifische Artefakte und Formalien als bestimmte Medientechnologien ausgewiesen werden. So wie diese in den Horrorfilmen angewendet werden, finden sie sich heutzutage viel verbreitet in Sammlungen von Glitch-Effekten zur Videobearbeitung oder in populären Musikvideos und Kamerafiltern.
Was hingegen die Glitch Art über die Produktion der Effekte mit den Found Footage Horrorfilmen verbindet, ist dass beide in ihrer Unabgeschlossenheit und Fehlerhaftigkeit dokumentiert und festgeschrieben werden. Ihr unsicherer und unheimlicher Status von Abgeschlossenheit wird nur zu diesem, weil die Hoffnung der Auflösung in der tatsächlichen Abgeschlossenheit nicht bedient wird: Beim Glitch zurück zur Funktionalität, beim Horrorfilm zurück zur Erlösung in der Erkenntnis, dass es ein fiktiver Film ist. Beide Auflösungen sind bereits im Vorhinein durch das Vorhaben ausgeschlossen. Was Glitch Art mit den Found Footage Horrorfilmen verbindet, ist dass sie beide in der Schwebe hängen.[17]
Gleichzeitig darf bei all dem nicht vergessen werden, dass sich die Filmzuschauer:innen darüber im Klaren sind, dass sie einen produzierten Film schauen. Auch wenn es hier natürlich Ausnahmen gibt, wie die Geschichte der Veröffentlichung von Blair Witch Project (1999) – einem weiteren Found Footage Horrorfilm – zeigt .[18] Ansonsten sind die Zuschauer:innen sich der Form bewusst und kennen die damit verbundene Invariabilität, auch wenn sie dieses Bewusstsein für eine Zeit freiwillig suspendieren. Ein Film auf einem Datenträger bleibt unverändert, nachdem ihn eine Person gesehen hat. Sowohl zwischen einer erneuten Sichtung als auch wenn eine andere Person den gleichen Film schaut, verändert sich am Material nichts. Anders verhält sich dies bei interaktiven Medien, wie den Video- und Computerspielen und bei vernetzten, wie Webseiten, welche fortlaufend neu angepasst werden können. Auch bei den Horrorfilmen ist es nicht unbedingt gleich offensichtlich, ob die mediale Störung ein genuines Problem der vorhandenen Technologien widerspiegelt, oder ob es ein intendierter Aspekt der fiktionalen Erfahrung ist.[19] Doch die Invariabilität der Filme verschafft dieser Unterscheidung sehr viel schneller Klarheit, als es bei Computerspielen und Websites möglich wäre. Websites gehen mit den Möglichkeiten einher, dass sie die Autor:innen jederzeit verändern und korrigieren. Vor allem in neueren Computerspielen, die auf Cloud-Servern gehostet sind, besteht diese Option. Dazu kommt bei Computerspielen, dass diese im Gegensatz zum Film den User:innen – und eben nicht mehr dem Publikum – erlauben, die Glitches zu erforschen, mit ihnen zu spielen und zu experimentieren.
Als Übergangsfigur zur Glitch Art und dem Computerspiel, möchte ich hier noch kurz Vanellope Von Schweetz erwähnen, ein Charakter aus dem Disneyfilm Wreck it Ralph (2012). Dieser vereint die visuellen Glitch Artefakte im Film, mit dem Glitch als technische Störung im Computerspiel und überbrückt dabei die Grenzen einer medienspezifischen Glitch Ästhetik – eine Überbrückung, welche die Effekte einer Transgression von systemischen und systematischen Normen erkundet,[20] in der Befreiung und Ausschluss eng miteinander verbunden sind.
[1] Vgl. Shaviro, Steven. What is the post-cinematic? 2011. http://www.shaviro.com/Blog/?p=992 (Stand: 17.02.2023). [2] Vgl. Grisham et al., 2016: S. 843; Rombes, 2009: S. 16. [3] Vgl. Bolter & Grusin, 2000. [4] Vgl. Kim, 2016: S. 102. [5] Temkin, Daniel. Glitchometry, 2011. https://danieltemkin.com/Glitchometry (Stand 17.02.2023) [6] Vgl. Bolter & Grusin, 2000: S. 31 ff. [7] Crawford, 2019: S. 83. [8] Menkman, 2011b: S. 44. [9] Vgl. Shaviro, Steven. What is the post-cinematic? 2011. http://www.shaviro.com/Blog/?p=992 (Stand: 17.02.2023). [10] Olivier, 2015: S. 253. [11] Ebd.: S. 253. [12] Menkman, 2011b: S. 44. [13] Vgl. Grisham et al., 2016: S. 842. [14] Die Argumentation hier ist in Teilen durch das Vertical Framing Video Essay (2014) von Miriam Ross informiert. Vgl. Ross, Miriam. Vertical Framing Video Essay. 2014. https://vimeo.com/99499627 (Stand: 17.02.2023). [15] Vgl. Crawford, 2019: S. 74 f. [16] Menkman, 2011b: S. 58. [17] Dieses Argument trifft ebenso – und durch deren potentiellen Live-Update Charakter nebst der Hypertextualität vielleicht noch besser – auf die "Found document"-Websiten zu, in denen eine Horrorgeschichte unaufgelöst bleibt, weil ihr nächstes, respektive letztes Update pendent bleibt. Vgl. Crawford, 2019: S. 75 f. [18] Vgl. Crawford, 2019: S. 73. [19] Vgl. ebd.: S. 80. [20] Vgl. Olivier, 2015: S. 264, Fussnote 41.