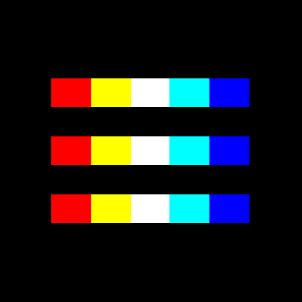2.2. Diskursanalyse
- Marinus Börlin
- 16. Feb. 2023
- 5 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Feb. 2023

Die Diskursanalyse ist keine eindeutige Methodik, im Sinne einer Anleitung zum planmäßigen Vorgehen, sondern wird hier mehr als Erläuterung der Beschaffenheit des Gegenstands verstanden. Dadurch ergeben sich bestimmte Implikationen, wie an diesen herangegangen wird. Die in der Untersuchung der Glitch Art enthaltenen diskurstheoretischen Aspekte, sollen demnach hier erkläutert werden.
Die Diskursanalyse baut auf methodologischen Gedanken auf, wie sie in der Archäologie des Wissens von Michel Foucault ausgeführt werden,[1] auch wenn sich deren Grundstrukturen schon in dessen früheren Werken finden lassen.[2] So formuliert er die Frage in Die Geburt der Klinik zusammenfassend:
„Wäre nicht eine Diskursanalyse möglich, die in dem, was gesagt worden ist, keinen Rest und keinen Überschuss, sondern nur das Faktum seines historischen Erscheinens voraussetzt? […] Der Sinn einer Aussage wäre nicht definiert durch den Schatz der in ihr enthaltenen Intentionen, [...] sondern durch die Differenz, die sie an andere wirkliche und mögliche, gleichzeitige oder in der Zeit entgegengesetzte Aussagen anfügt.“[3]
Das Ziel dieses Unterfangens ist also nicht die Suche nach der unterstellten Bedeutung in jeder Aussage, sondern nach dem Zusammenhang zwischen den Aussagen und den Regeln respektive Formationen, welche diese hervorbringen. Allem voran geht die Diskursanalyse von historischen Argumentationen aus und ihre Gegenstände sind damit zusammenhängend nie prädiskursiv. Damit ist nicht gemeint, dass sie zeitlich-lineare Entwicklungen in einer konsekutiven Geschichte beschreibt, sondern Ordnungen des Wissens, die ihre Spezifität durch zeitlich festgelegte Möglichkeitsbedingungen erhalten, durch eine „Menge von Beziehungen, die unabhängig von den verknüpften Elementen fortbestehen und sich verändern.“[4] Dass die Gegenstände nicht prädiskursiv sind, markiert dabei die Abkehr von Universalwahrheiten oder einer Universalgeschichte, die auf objektiv nachvollziehbaren und unveränderbaren Grundlagen aufbauen würde und situiert die Diskursanalyse im breiteren Feld der postmodernen Strömungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Beispiel dieser Abkehr mit weitreichenden Folgen, welches für das fünfte Kapitel dieser Arbeit relevant wird, ist dass dabei auch das Subjekt als historischer Effekt bestimmter Diskurse gesehen wird und nicht als deren Ausgangsbedingung.[5]
Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diskurses resultieren demnach nicht aus den Geniestreichen individueller Akteur:innen, sondern lassen sich nur aus den spezifischen Gegebenheiten eines jeden zeitlich und örtlich bestimmbaren Archivs aus diskursiven, sowie nicht-diskursiven Elementen ableiten. Während Foucault den Diskurs in der Archäologie des Wissens noch hauptsächlich anhand intradiskursiver Formation behandelt, als Menge von regelnden und geregelten Praktiken des Denkens, Schreibens, Sprechens und Handelns,[6] ergänzt er diese in der Ordnung des Diskurses über das Diskursive hinaus mit den extradiskursiven Elementen sozialer Praxen und Wissensverarbeitungsformen, wie auch den damit verbundenen Institutionen. Diese Elemente, zwischen denen sich das ordnende Netz spannt, können so diverse Dinge umfassen wie Institutionen, Symboliken, Praktiken oder Technologien. Dabei geht es in diesem Archiv nicht um den Wahrheitsgehalt einer Aussage in Bezug auf eine prädiskursive Welt:[7]
"Das Wesentliche […] liegt in der Entdeckung und Vermessung dieses unbekannten Landes, in dem eine literarische Form, eine wissenschaftliche Proposition, ein alltäglicher Satz, ein schizophrener Unsinn usw. gleichermaßen Aussagen sind[.] […] Wissenschaft und Poesie sind gleichermaßen Wissen."[8]
Gegenstand der Untersuchung sind demzufolge nicht Dinge, Fakten, Realitäten oder Wesen, Abgrenzungen von wichtigen und unbedeutenden Ereignissen, sondern Möglichkeitsbedingungen von Aussagen, Existenzregeln von Gegenständen und "Typen von Ereignissen völlig unterschiedlichen Niveaus".[9] "Das Archiv ist zunächst das Gesetz dessen, was gesagt werden kann, das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht.“[10]
Von besonderem Interesse ist die Diskursanalyse für das vorliegende Thema nicht zuletzt aufgrund der von Winthrop-Young angemerkten Ähnlichkeit zwischen Foucaults Diskursanalyse und Shannons mathematischer Kommunikationstheorie.
"Die Rigorosität, mit der Shannon die herkömmliche Beziehung zwischen Information und Bedeutung kappt, erinnert an Foucaults gleichermaßen rigorose antihermeneutische Analyse von Wissenskonfigurationen. Die Parallelen sind auffällig: In beiden Fällen geht es weniger um individuelle Aussagen als um Aussagenensembles; es geht nicht um Bedeutungsfragen, sondern um die faktische Tatsache, dass etwas gesagt wird und dass diese Aussage immer vor dem Hintergrund dessen gesehen werden muss, was stattdessen hätte gesagt werden können; und es geht um Regeln, die vorschreiben, dass die Auswahl einer bestimmten Aussage bzw. eines Zeichens sich auf die Auftrittswahrscheinlichkeit nachfolgender Zeichen/Aussagen auswirken kann."[11]
Der Einsatz von Foucaults Diskursanalyse muss hier wohl oder übel auf die ihr gegenüber verbreitete Kritik reagieren, dass durch sie zu wenig auf die technischen Beschaffenheiten der unterschiedlichen diskurstragenden und -vermittelnden Medien eingegangen wird und hauptsächlich an den Medien der "Gutenberggalaxis" entlang gedacht wird.[12] Diese Kritik ist auf jeden Fall berechtigt und sie wird beispielsweise in der Übernahme der Diskursanalyse in eine Medienarchäologie angegangen.[13] Sie muss jedoch auch relativiert werden, denn Foucault als rein textorientierten Forscher abzustempeln, würde einen breiten Teil seiner Arbeiten ignorieren, wie Beispielsweise seine Texte zu Velázquez oder Manet. Die Felder des Sichtbaren, die er in diesen beschreibt verweisen auf ein enges Verhältnis zwischen diesem Sichtbaren und dem Sagbaren, zwischen dem Bild und der Aussage, welche trotz der jeweils eigenen Seinsweisen eine "komplexe, verschachtelte Beziehung“[14] führen.
In einer genealogischen, diskursanalytischen Annäherung an das Phänomen von Glitch Art und die Prozesse deren Verbreitung geht es folglich nicht um die Überprüfung von Aussagen oder um Ursprünge, sondern um historische Angliederungen und Resonanzen. "Die Herkunft macht es auch möglich, unter der scheinbaren Einheit eines Merkmals oder Begriffs die vielfältigen Ereignisse ausfindig zu machen, durch die (gegen die) sie sich gebildet haben."[15]
Die Diskursanalyse als methodisch-theoretisches Fundament und die Website als Formation des Denkens und Schreibens passen insofern gut zusammen, als dass über die hypertextuelle Struktur der Website die Gedanken weniger entlang einer linearen Musterung aufgebaut werden und mehr ein Feld von verbundenen Diskursen und Bedingungen darstellen.
Die vorliegenden Erkenntnisse, Vorschläge, Theorien, Aussagen und Werke sind in vielerlei Hinsicht Netzwerken verbunden. Allem voran ist der Untersuchungsgegenstand – falls dieser noch als solcher bezeichnet werden kann – ein Netzwerk von Künstler:innen, Praktiken, Medientechnologien, Diskursen, Institutionen Prozessen und weiteren Entitäten. Ausserdem entsteht und floriert die Glitch Art in einem gesellschaftlichen System dessen für sie relevante Faktoren häufig als Netzwerkgesellschaft bezeichnet werden. Diese ist konstitutiv für die Glitch Art, welche ihrerseits auf die Netzwerkgesellschaft reagiert. Und zuletzt hat das Netzwerk schlechthin, das Internet, eine prägende Rolle in der vorliegenden Forschung gespielt, da ein Grossteil der Recherche und der Entwicklung des Gegenstands, sowie die Präsentation der Erkenntnisse darüber stattgefunden haben. Um den mannigfaltigen Netzwerken getreu zu werden, bediene ich mich auch dieser Form, die Stränge neu zu verknoten und übernehme die Formulierung einer anderen Netzwerkanalyse:
"In this sense, we hope you will experience the [website] not as the step-by-step propositional evolution of a complete theory but as a series of marginal claims, disconnected in a living environment of many thoughts, distributed across as many pages."[16]
[1] Vgl. Sarasin, 2016: S. 69. [2] Vgl. ebd.: S. 64 ff. [3] Foucault, 2005: S. 15. [4] Foucault, 2001a: S. 665. [5] Vgl. Pias, 2010: S. 253. [6] Vgl. Parr, 2008: S. 234. [7] Vgl. Foucault, 1973: S. 14. [8] Deleuze, 1997: S. 34. [9] Foucault, 1973: S. 16. [10] Vgl. ebd.: S. 187. [11] Winthrop-Young, 2018: S. 138. [12] Vgl. Parr & Thiele, 2007: S. 84-85 & S. 88-91. [13] Vgl. Parikka, 2012: S. 6. [14] Foucault, 2001b: S. 796. [15] Foucault, 2014: S. 172. [16] Galloway & Thacker, 2007: S. vii.